Sick of Myself – Kritik
Entzückt vom bandagierten Gesicht: Kristoffer Borgli lässt in Sick of Myself seine Protagonistin für ein bisschen Aufmerksamkeit die eigene Gesundheit opfern – und karikiert dabei unsere distinktionsbesessene Gegenwart.

Das Münchhausen-Syndrom, bei dem Betroffene körperliche Beschwerden erfinden und teils selbst hervorrufen, wird auch Koryphäen-Killer-Syndrom genannt: nach dem ärztlichen Spitzenpersonal, das notwendigerweise an der Diagnostik der Patienten scheitert. Signe (Kristine Kujath Thorp), die Protagonistin von Kristoffer Borglis Kinodebut Sick of Myself, ist die personifizierte Zwangsheirat zwischen Narzissmus, Abhängigkeit und Koryphäen-Killertum. Von ihrem gleichsam selbstzentrierten Künstler-Boyfriend Thomas (Eirik Sæther) um die absolute Aufmerksamkeit betrogen, zu der sie sich berechtigt fühlt, greift sie zu immer drastischeren Mitteln. Von der einfachen Lüge oder Diebstahl und Zechprellen in Komplizenschaft mit Thomas über das Vortäuschen einer Nussallergie oder dem Versuch, von einem Hund gebissen zu werden, bis hin zur Ultima Ratio: einem russischen Medikament, zu dessen unerwünschten Nebenwirkungen schwerste Nekrosen insbesondere im Gesicht zählen.
Unerwünschte Nebenwirkungen

Als Signe in den sozialen Medien liest, wie viel Aufmerksamkeit den Opfern von Lidexol zuteil wird, sieht sie die Stunde gekommen, in der sie Thomas florierender Künstlerkarriere die Schau stehlen kann. Der junge Mann, der die gemeinsam gestohlenen Sitzmöbel zu auffälligen Skulpturen verarbeitet, landet schließlich ein erstes großes Interview. Als das Fotografenteam der Zeitung in der gemeinsamen Wohnung arbeitet, hat Signe sich schon so viel Darknet-Stoff eingeflößt, dass sie umkippt. Sie landet in einem Fiebertraum mit Anders Danielsen Lie als Arzt, der ihr vor Augen führt, was sie für ein schlechter Mensch ist. Und wacht mit einem bandagierten Gesicht auf. Sie ist entzückt und fotografiert sich prompt im Krankenhausspiegel.
Einen solchen Spiegel hält uns der 38-jährige Kristoffer Borgli mit dieser Erzählung natürlich auch vor. Es bedarf keiner weiteren Zeigefinger, um zu erkennen, für was Signes selbstzerstörerische Hypernarzissmus steht: Kunst- und Modeszene, Social Media und Boulevardpresse als die besonders leuchtenden Spitzen eines Eisbergs an Individualismus und Distinktionsbesessenheit. Alles so überdreht, dass nicht nur die eigene Gesundheit – wie schon im 20. Jahrhundert –, sondern selbst die sonst so wohlgehütete Schönheit dafür über Bord geworfen wird. Und ist für ein Inklusions-Label modeln nicht ohnehin der bessere Spin?

Signe findet auf ihrem kompromisslosen Weg in die Berühmtheit immer neue Erzählungen, die sie im Fallen halten, den Aufprall noch ein letztes Mal vermeiden. Das geht so weit, dass sie sogar über das in der Münchhausenschen Logik Undenkbare sinniert: ihrer Journalistenfreundin alles zu beichten, die selbstinduzierte Krankheit, die Lügen – um mit dieser Geschichte wiederum zu Ruhm zu kommen.
Sich in Lügen verstricken
Signes Fantasien werden in Sick of Myself stets quicklebendig. Sie treten als Halluzinationen in die mit Designermöbeln ausstaffierte Filmwelt, erfüllen ihre Träume. Bis die Wirklichkeit wieder über ihnen kollabiert, inklusive Erbrechen und an der Tischkante aufschlagen. Auf diese Weise straft sich der Film immer wieder selbst Lügen, was umso interessanter wird, je mehr sich Signe in ihre verstrickt. Was in Sick of Myself zu sehen ist, steht ständig unter dem Vorbehalt, entweder wild fantasiert zu sein oder kurzerhand anders entschieden zu werden. Wenn Signe es deutlich abwehrt, mit der Mutter ihres Jugendfreundes gemeinsam Kaffee zu trinken, sitzt sie einen Schnitt später mit ihr am Tisch. Ein Ausstellungstitel auf Norwegisch – geht gar nicht, und schon prangt ein norwegischer Titel am Schaufenster. Auf eine sehr filmische Weise wird uns so einerseits nahegebracht, wie labil die Wahrheit ist, und andererseits, wie schwer es auszuhalten ist, wenn jede Integrität fehlt.

Der werbliche Untertitel des Films verspricht „eine unromantische Komödie“. Aber Sick of Myself ist mehr als unromantisch – er und seine Protagonistin sind manchmal sogar unmenschlich. Im Laufe der Zeit verwandelt sich Signes Gesicht zu einem Body-Horror-Schauplatz und mit diesem verfällt auch unser Bild von der zunächst sympathischen jungen Frau, die zum Ungeheuer wird. Das mündet auch in einer etwas flachen Didaktik: wie innen, so außen.
Uns soll immer wieder das Lachen im Halse stecken bleiben, und das gelingt. In den Zirkeln, in denen Signe sich bewegt, scheint Aufmerksamkeit ein existenzielles Gut zu sein, Narzissmus ein Einstellungskriterium. Dass wir daran viel von unserer eigenen Arbeits-, Gefühls- und Lebensrealität erkennen können, macht Sick of Myself zu einer bitteren Pille.
Neue Kritiken

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Die Spalte
Trailer zu „Sick of Myself“

Trailer ansehen (1)
Bilder



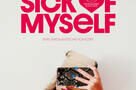
zur Galerie (9 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.












