Samaria – Kritik
Samaria ist eine ungewöhnliche und faszinierend moralische Geschichte über den Sündenfall, die Vergebung und nicht religiöse Nächstenliebe, deren Hauptplotelement Kinderprostitution nur als Aufhänger der Diskurse dient. Das spröde Werk des Koreaners Kim Ki-Duk bleibt gewollt unzugänglich und sperrig.

Mit Frühling, Sommer, Herbst, Winter… und Frühling (Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom, 2003) hat Regisseur Kim Ki-Duk eines der Glanzlichter des vergangenen Jahres gesetzt. Die Geschichte eines Mönchs und dessen Schülers in der Einsamkeit eines koreanischen Bergsees strotzt vor visueller Kraft und kann in diesem Bewusstsein auf viel Dialog verzichten. Zudem lässt der Film seinem Betrachter Freiraum, die metaphorische Erzählung zu deuten. Kim Ki-Duk ist diesem Konzept treu geblieben und hat in diesem Jahr recht umstritten den Preis der Berlinale für seine Regie von Samaria gewonnen. Auch in dieser Geschichte um ein junges Schulmädchen verlässt sich Kim auf die Bildsprache, klammert vor allem zum Ende hin den Dialog beinahe gänzlich aus und konfrontiert den Zuschauer mit einer kryptischen Erzählung über den Verlust der Unschuld, die viel Interpretationsraum lässt.
Jae-Young (Seo Min-Jung) verkauft ihren Körper, um mit dem ersparten Geld Europa bereisen zu können. Ihr Vorbild dabei ist Vasumitra, der es gelang, Männer durch glücklichen Sex zu Buddha zu bekehren. Ihre Freundin Yeo-Jin (Kwak Ji-Min) partizipiert nur als Organisatorin an dem sexuellen Betrieb. Als sie ihrer Aufgabe als Wachposten nicht nachkommt, führt dies zum Unglück. Mit dem Vermächtnis ihrer Freundin, deren Adressbuch, ausgestattet, nimmt nun Yeo-Jin die Rolle der Samariterin an. Als ihr Vater (Lee Uhl), ein Polizist, dies erfährt, steuert die Tragödie ihrem kathartischen Ende entgegen.
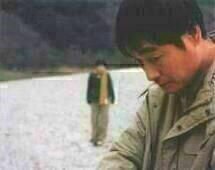
Zwar findet der Regisseur bereits vorher Bilder mit berechnendem Schockeffekt, doch es ist jene Schlusssequenz, die Kim Ki-Duks virtuose Verknüpfung von bildlicher Schönheit und menschlichem Schmerz am eindrucksvollsten exponiert und sich beinahe traumatisch in das Gedächtnis einbrennt. Obwohl Kim seine Figuren rigoros und beinahe mechanisch diesem tragischen Ende entgegenführt, gelingt es ihm, ohne eine gewöhnliche Spannungsdramaturgie zu operieren. Die drei Akte schildern in gleich bleibender Langsamkeit jeweils aus verschiedenen Perspektiven das Geschehen. Zunächst steht Jae-Young im Mittelpunkt des Geschehens, dann rückt ihre Freundin dorthin und das Finale vermittelt sich über den Blick des Vaters. Dennoch nimmt der Betrachter niemals die Haltung eines der Protagonisten an, Kim wahrt mit seinen fernen Einstellungen immer die Distanz.
Folglich entwickelt sich ein Bilderfluss, der von Verweisen gespickt ist. Zuweilen scheint die Überdeterminierung den kunstvollen und suggestivkräftigen Bildern jedoch zu schaden. Kim etabliert ein Geflecht von Bildern, Metaphern und Bezügen, das sich beizeiten in seinem Verweischarakter genügt. In kargen kalten Bildern von religiöser Metaphorik eröffnet der Regisseur einen Diskurs über Schuld, Sühne, Vergebung und Läuterung, den der Zuschauer alleine zu Ende führen muss, zu einem Dialog kommt es nicht.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Neue Trailer
Kommentare
Svend
Muss leider sagen, dass mich der Film nicht gerade aus den Socken gehauen hat. Gut, wenn die Story dann erstmal läuft, ist Samaria keineswegs langweilig oder gar schlecht. Aber...wie muss man eigentlich drauf sein, um mit den ganzen widerlichen Freiern zu schlafen und ihnen noch das Geld zurückzugeben...ich glaub, kein vernünftiger Mensch (auch wenn es sich hier um ein pubertierendes Mädchen handelt) kommt auf so eine hirnrissige Idee. Ansonsten find ich den Film stilistisch und atmosphärisch sehr gelungen!
Anonym
Im Film geht es, wie mir scheint, auch um Fremdheit (und Selbsterfindung) u.a. sich selbst gegenüber. Das Leben des Mädchens das angeschafft hat wird sozusagen von ihrer Freundin dekonstruiert, aber das ist nicht so einfach wie sich es vorgestellt hat. Es ist somit sehr konsequent uns eine Fremdartigkeit der Figuren zu schaffen.
arbol
Eine langsame, geniale Geschichte, ausgedrückt durch Metaphern und Symbolen statt mit Worten.











3 Kommentare