Rose Bernd – Kritik
Neu auf DVD: In Wolfgang Staudtes Gerhard-Hauptmann-Adaption Rose Bernd (1957) implodiert eine Frau zwischen den Ansprüchen, die drei Männer auf sie erheben. Das Melodrama ist dabei derart intensiv, das es bisweilen zum Terrorkino wird.

Die Rose ist die Blume der Liebe, ein komplexes Ding. Auf der einen Seite zart, schön und wohlriechend. Auf der anderen Seite voller Dornen, die alles aufreißen wollen, das sich der Blume zu unvorsichtig nähert. Von glühendem Rot ist sie. Aber die Rose ist nicht das Faszinierende am Titel von Wolfgang Staudtes Film. Dieser Part kommt Bernd zu. Sicherlich gab und gibt es filigrane Träger des Namens, aber der Name selbst hört sich nicht so an. Er hat etwas Dumpfes, Einfaches und ist – im Gegensatz zur Rose – männlich. Ein Wort aus zwei knappen Silben und eines aus einer ausgedehnten bilden den Titel: Rose Bernd. Wobei Bernd nicht nur das Gegenteil von der Rose bildet. Vielmehr wird diese durch ihn angegangen, umgedeutet, befallen. Die Kraft des Titels liegt darin, wie unstimmig er wirkt und im Widerstreit seiner beiden Elemente. Die Wirkung ist so faszinierend, wie der Film selbst damit ziemlich genau getroffen wird.
Das Lachen gegen lächerliches Verhalten

Wobei: Rose (Maria Schell) ist auffallend undornig. Stattdessen lacht sie. Die erste Hälfte des Films fast durchgehend. Unbedarft und freudig. Wenn sie arbeitet, tanzt oder Baggerführer Streckmann (Raf Vallone) reglos an die Wand gepresst findet, weil er beim nächtlichen Besuch im Hof nicht auf Rose traf, sondern auf den Wachhund. Die dezidierte Leichtigkeit ihres Lachens hat etwas Kämpferisches. Tatsächlich scheint sie die ständigen Zudringlichkeiten der Männer nämlich wie an einer solchen Wand abprallen lassen zu wollen. Es ist ein Lachen, das ihnen klarzumachen versucht, dass ihr Verhalten bestenfalls etwas lächerlich ist.
Vater Bernd (Arthur Wiesner) verlangt von seiner Tochter ein gottgefälliges Leben. Wiederholt baut er sich vor ihr auf und verlangt von ihr, dass sie auf die Bibel schwöre, dass sie nicht gefehlt haben möge. Streckmann hingegen baut unablässig seinen muskulösen Körper vor ihr auf und möchte von ihr – wie von jeder anderen jungen Frau des Films – Sex. Weil Rose zwar lacht, aber nicht nachgibt, wirft er nachts Sand an ihr Fenster, auf dass sie herunterkomme, und sucht sie auch tagsüber ständig auf. Flamm (Leopold Biberti), der Rose als Kind auf seinem Hof aufgenommen und als Magd beschäftigt hat, bemerkt, dass sie eine Frau geworden ist. Also kommt er ungefragt in ihr Zimmer und ihr Bett und will die quasi väterliche Beziehung entschieden umgestalten. Körperlichen Ersatz für seine an den Rollstuhl gefesselte Frau (Käthe Gold) sucht er.
Vom Drama zum Horror

Die Ansprüche, die diese drei Männer auf Rose erheben, spannen das Melodrama auf, das sich entwickeln wird. Die Dornen finden sich deshalb nicht an Rose, sondern an ihren Wünschen nach Liebe und nach väterlicher Anerkennung. Weil beides in diesem Biotop nicht geht, gemeinsam, findet sie sich in Widersprüchen gefangen. Zwischen der Erfüllung eines einfachen, landwirtschaftlichen Lebens, wenn Rose bei der Arbeit mit Tieren und Heu in sich ruht, und dem Wunsch nach Spaß, Tanz und Leidenschaft. Zwischen Religion und „Verderbnis“. Zwischen den karg eingerichteten, puritanischen Räumen – besseren Gefängniszellen – und den optischen Ausbrüchen von Leidenschaft, wenn beispielsweise Rose tanzen geht und sich der Wirtsraum schwindelig machend um Rose dreht, oder wenn die Kamera in einem Rapsfeld steht und ein knalliges Gelb die ansonsten erdigen Töne des Agfacolor-Films intensiv leuchten lässt.
Die Intensität des Melodramas wird dabei dermaßen hochgehalten, dass er zuweilen ins Terrorkino kippt. Rose leidet nicht einfach nur, sie wird zerstört. Aus ihrem Lachen wird langsam, aber nachdrücklich eine implodierende Hysterie. Sie wird schwanger werden und die Geburt sieht nicht aus, als ob etwas aus ihr herauskommt, sondern als ob sie von einem riesigen Monster unter eine Brücke gezogen wird. So wie sich dieser scheinbare Heimatfilm Richtung Horror bewegt, ähnelt er einem Film wie Hans H. Königs Rosen blühen auf dem Heidegrab (1952). Nur während der Gothic-Horror dort allgegenwärtig ist und uns aus den Schatten und dem Schweigen anfällt, sieht hier alles über lange Strecken nach einer halbwegs heilen Welt aus. Wie schlimm es in ihr zugeht, offenbart sich erst nach und nach.
Belagerndes Begehren

Das Leid der Frau ist dabei sicherlich am expressivsten, die Stärke des Films liegt aber in der Darstellung nicht des Leidens, sondern der Belagerung. Grundsätzlich ist Rose völlig isoliert. Die einzigen anderen Figuren sind Siegfried Lowitz als Ankläger, Drucker Keil (Hannes Messemer), der Rose zwar liebt, der aber so wenig attraktiv und anziehend wie hilfreich ist. Und zwischen Frau Flamm und ihr stehen Eifersucht und ein schlechtes Gewissen – als gesenkte und abgewendete Blicke.
Die Belagerung selbst geht von besagten drei Männern aus, deren unterschiedliche Interessen an ihr Rose zwar zerreißen, die aber auch die gleiche Überzeugung zu teilen scheinen, es sei ihr natürliches Recht, zu herrschen und zu verlangen. „Ich krieg dich schon noch dahin, wohin ich dich haben will!“, ruft Streckmann, der wie die anderen in Rose nur eine Art belebtes Ding sieht und keine Gedanken an die Konsequenzen verschwendet, die sein Begehren für sie bedeutet. Gegenüber Kritik rechtfertigen sich die drei nicht einmal, sie verbieten einfach den Mund. Das, was wir sahen, werden sie, ohne mit der Wimper zu zucken, so umdeuten, dass das „Frauenzimmer“ Schuld hat. Das Drehbuch nach dem Stück Gerhart Hauptmanns und die Darsteller (und Sprecher – Wolfgang Lukschy synchronisiert Raf Vallone) zeigen eindrückliche Herrenmenschen.

Auch wenn dies alles im Horror endet, wirkt Rose Bernd lange wie ein stilles Drama. Aber in dieser Ruhe findet sich von Beginn weg ein konstanter Zustand von Einschließung und Konfrontation. Letzteres auch gegenüber dem Zuschauer, wenn Leute hier und da auf die Kamera zugehen oder sich vor ihr aufbauen. Die Unmöglichkeit des Einspruchs gegen die Logik der Männer, die trotz ihrer gegenseitigen Abneigung dann doch eine geschlossene Front bilden, ist der brutalste Aspekt des Herausreißens von Rose, wie der mörderische Vorgang des Pflückens wohl besser beschrieben ist. In diesem unscheinbaren idyllischen Stück Deutschland wird auf diese Weise ein solcher Grad von wunderschön gefilmter Unannehmlichkeit erreicht, der schon hier in Richtung des Kinos von Rainer Werner Fassbinder weist.
Neue Kritiken

Crocodile

Auslandsreise

AnyMart

Allegro Pastell
Bilder zu „Rose Bernd“


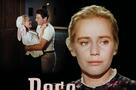

zur Galerie (9 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.












