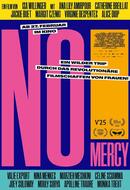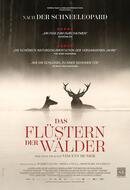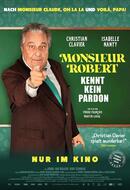Roma – Kritik
Arbeit am Bild, Arbeit im Bild. Alfonso Cuaróns Kindheits-Rekonstruktion Roma ist nicht nur ein betörendes Stück Kino, das unbedingt auf die große Leinwand gehört, sondern auch ein kluger Film über Körper und Verhältnisse aller Art.

Die Leinwand muss nass werden, bevor sich etwas darin spiegeln kann, bevor wir etwas sehen können. Erst als ein genügend dichter Wasserfilm auf dem Boden liegt, sind da auch Wolken, fliegt da ein Flugzeug über Mexiko hinweg, ist da Welt. Als die Credits vorbei sind, die Kamera langsam aufschaut, erkennen wir: Es geht hier nicht um visuelle Poesie als solche, sondern um die Arbeit dahinter. Cleo wässert den Hof. Das Wasser, in dem sich der Himmel spiegelte, war weder romantischer Regen noch erhabener Ozean, sondern Putzwasser. Ohne Arbeit keine Wolken, kein Flugzeug, kein Film. Roma nimmt das Bild nicht als gegeben hin.
Arbeit

Auch die Affekte sind Teil der Arbeit. Denn im Zentrum von Alfonso Cuaróns Rekonstruktion der eigenen Kindheit in den frühen 1970er Jahren in der Colonia Roma, einem Viertel von Mexiko-Stadt, steht nicht die liebende Mutter, sondern die liebende Haushälterin, nicht das Ehedrama, das wir uns langsam zusammenreimen, sondern die materielle Basis, die das bürgerliche Drama erst ermöglicht. Das ist Cleo: Putzen, spülen, kochen, Wäsche aufhängen, Kinder lieben und, quite literally, Leben retten. Auch wenn sie sich dann mal zur Familie setzt, Teil der Gemeinschaft vor dem Fernseher wird und sich an eines der Kinder kuschelt, bleibt sie auf Abruf, holt sie irgendwann den Tee, der das Familienbild noch perfekter macht.
Roma findet gerade in den frühen Innenaufnahmen eine entsprechende Bewegungsökonomie: Langsam durchschwenkt Cuaróns Kamera das sorgsam eingerichtete Obere-Mittelklassen-Haus, Cleo bewegt sich durch diesen Raum zugleich präzise und unpassend, wie sich eine Frau eben bewegt, die ein Heim als Maschine beherrscht, aber von seiner Fassade nichts hat, die dort nur arbeitet, wo andere leben. Cleo ist auch Vermittlerin. Hält die einzig noch ungelenkeren, noch weniger angemessenen Bewegungen im Zaum: die aufgekratzten Kinder und vor allem Hund Borras, der jedes Mal lauthals bellend zur Hauspforte rennt, wenn er eine Ankunft wittert und den Rest der Zeit damit zuzubringen scheint, die Einfahrt zuzukacken.
Liebe

Roma besteht aus episch anmutenden Schwarz-Weiß-Tableaus, die wundervoll durchkomponiert, teilweise aufwändig choreografiert sind. In denen aber niemals alles aufgeht, weil immer auch Produktions- und Machtverhältnisse im Bild sind. Keine fertigen Ornamente, sondern museale Reibungsflächen. Die Bilder wirken zugleich erinnert und sind doch unmittelbar präsent, scheinen Platzhalter für diffusere Stimmungen und sind doch stets ganz konkrete Situationen. Es sind, ohne Frage, Erinnerungen, aber in ihnen wird gelebt, geliebt und geschossen. Einmal bebt die Erde, einmal brennt’s im Wald.
Cleo, die sich mit ihrer Kollegin auch mal im indigenen Mixtekisch verständigt, belebt diesen Film, und der Film belebt sie, nimmt sich ihrer Geschichte an, holt ihr Begehren ins Bild. Der zentrale Konflikt in nur einer Einstellung: Cleo gesteht ihrem Geliebten Fermín im Kinosessel, dass sie schwanger ist, während im Hintergrund eine irrwitzige Fliegerkomödie läuft. Der freut sich, entschuldigt sich, geht aufs Klo und kommt nicht wieder. Cleo bleibt noch ein wenig sitzen, den Blick immer wieder nach hinten gerichtet, weg von der Leinwand, hin zum Ausgang. Versperrt uns damit auch die unschuldige Sicht aufs Kino.

Die Männerflucht hätte man ahnen können: Nackt stand Fermín nach dem Sex vor dem Bett, um Cleo seine Stockkampf-Künste mit der Duschvorhangstange vorzuführen. Cleo kicherte ein bisschen, aber Cuarón war es ernst mit diesem Bild. Harte Stange in der Hand, schlaffer Schwanz am Körper: die proletarische Version jener Sequenz, in der das Oberhaupt der bürgerlichen Familie den Ford Galaxy in die Garage fährt. Ob gepanzert oder nackt: Die Männer sind Schlappschwänze, auf Stangen und Karren angewiesen, verschwinden aus dem Kino und auf angebliche Geschäftsreisen. Da nimmt Cuarón seine Bestandsaufnahme mexikanischer Männlichkeit aus Sólo con tu pareja (1991) und Y tu mamá también (2001) wieder auf.
Kino

In gewisser Weise trifft in Roma dieses Frühwerk auf Cuaróns Hollywoodfilme. Der Klassiker Verschollen im Weltraum (Marooned, 1969), Inspiration für Cuaróns Gravity, hat einen Cameo-Auftritt, die Frage der Reproduktion, um die es in der Zukunftsvision Children of Men ging, hallt wider in den zwei brutalsten Plansequenzen, die jene einfache Frage aufgreifen, wessen Leben noch zu retten, welches hoffnungslos ist.
Und selbst die mehr als offensichtlichen filmgeschichtlichen Referenzen sind keine Poserei, sondern schärfen die eigene Welt. Nicht nur der Filmtitel, auch die zirkusartigen Bizarrerien am Rande – ein Laster wird im TV mit den Zähnen bewegt, eine menschliche Kanonenkugel fliegt durchs Bild – gemahnen an Fellini, sprechen aber zugleich vom nationalen Größenwahn Nachkriegsmexikos. Bei noch reicheren Verwandten der Familie auf dem Lande gibt es eine Schießübung, die bewaffnete Dekadenz erinnert an jene berühmte Szene aus Jean Renoirs Spielregel (1939) – kündet hier nur nicht vom Zweiten Weltkrieg, sondern vom Horror des Corpus-Christi-Massakers, das Cuarón in Roma auch mit in die Erinnerungsarbeit holt. Roma beschwört die großen Motive des europäischen Autorenfilms nicht nur, sondern überträgt sie auf postkoloniale Verhältnisse, in denen sich die oberen Klassen ja gerade über eine imaginierte Nähe zu Europa mit kultureller Autorität auszustatten suchen.
Verkörperte Verhältnisse

So ist Roma ein wunderschöner, aber eben auch ein äußerst schlauer Film. Von jedem seiner Bilder ließe er sich anfangen zu denken, in seiner poetischen Form wie in seiner kritischen Substanz. Ein Film der Körper: arbeitende Körper, bürgerliche Körper, proletarische Körper, männliche und weibliche Körper, kindliche und tierische Körper, bizarre Körper, kämpfende Körper, gestählte Körper, schwangere Körper, sterbende Körper, durch die Luft fliegende Körper, totgeborene Körper.
Und ein Film der Verhältnisse: der Produktions- und Reproduktionsverhältnisse, der Klassen-, Geschlechter- und kolonialen Verhältnisse, der Verhältnisse zur persönlichen Erinnerung und zur nationalen Geschichte. Nichts davon kommt sich je in die Quere, weil all diese Dinge nicht als Themen gesetzt werden, sondern unmittelbar in diesen Körpern stecken und über ihre Bewegungen vermittelt werden. Roma erklärt die Verhältnisse nicht, sondern macht sich von ihnen ein Bild – darum wissend, dass immer jemand eine Fläche putzen muss, damit wir die Wolken sehen können.
Neue Kritiken

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother

The Day She Returns

Prénoms
Trailer zu „Roma“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (10 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.