Querelle – Kritik
Alle Widersprüche in einem Tropfen Spucke.
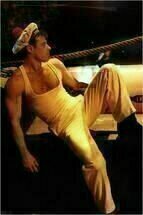
Querelle ist weder Fassbinders Vermächtnis noch sein Schwanengesang. Es ist nur zufällig der letzte Film, den der getriebene Ewigarbeiter fertigstellte, bevor er am 10. Juni 1982 verstarb, vollgepumpt mit Drogen, den Kopf auf seinem nächsten Drehbuchentwurf. Querelle wurde von zeitgenössischen Kritikern verschmäht und bleibt bis heute eine der großen Eigenartigkeiten des an Exzentrik nicht armen Schaffens Fassbinders.
Querelles filmische Schwächen und Wagnisse stehen jedem Versuch im Wege, das unebene Werk des größten deutschen Nachkriegsregisseurs nachträglich zu glätten, große Linien der Auseinandersetzung nachzuzeichnen und schlüssige Interpretationen seines Opus zu konstruieren. So bildet der Film den ultimativen Prüfstein jeder Autorentheorie, die sich an einem unabgeschlossenen Werkkorpus abarbeiten muss. Ein Ende ohne Schluss. Und doch kommt man nicht umhin, Querelle mit einer gewissen Wehmut, gar Rührseligkeit zu begegnen.
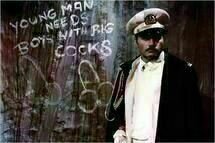
Denn dies ist wohl ein Paradebeispiel dessen, was Truffaut einen „großen kranken Film“ genannt hat: ein Film, den man für seine Fehltritte mindestens ebenso verehrt wie für seine Errungenschaften, ein Film, in den man sich verbeißen kann, der einem in Ablehnung wie in Ehrerbietung auf allen Ebenen herausfordert und keine Ruhe lässt. Eine Liebe, die Hass nicht als Gegensatz, sondern als notwendigen Teil einer vollkommenen Begegnung anerkennt, durchläuft im besten Fall alle Register der Kommunikation. Und Querelle ist ein Film, mit dem man sich auf allen Ebenen auseinandersetzen kann.
Liebe und Hass, Zu- und Abneigung, das Schöne und das Hässliche, Reinheit und liederlicher Ekel – die Weisen der Begegnung des Zuschauers mit Querelle bilden auch dessen thematische Substanz. Schwankend und taumelnd streift der Film einmal niedere Gefilde, Mord und Betrug, nur um zwei Schritte später mit Chören und neongelbem Postkartenkitsch der ewigen Liebe und dem perfekten Körper zu huldigen. Keine Zuneigung ohne Kampf: wenn sich der Matrose Querelle (Brad Davis) und sein Bruder Robert (Hanno Pöschl) nach langer Trennung in einem Puff am Hafen von Brest in die Arme fallen, dann umschlingen sie sich und prügeln zugleich aufeinander ein.

In solch sadomasochistischer Umarmung wiegen sich auch Fassbinder und die Wörter und Figuren Jean Genets, dessen Roman Querelle de Brest das Ausgangsmaterial des Filmes liefert. Um eine wirkliche Adaption handelt es sich dabei freilich nicht – eher um eine gleichermaßen von Wertschätzung und Skepsis gezeichnete Kollaboration. Fassbinder wahrt eine enorme ästhetische Distanz zum Text, ganz offensichtlich liebäugelt er mit dessen verquerer existenzialistischer Dramatisierung von Schwulsein, Verbrechen und Genuss, aber nicht minder deutlich misstraut er den lyrischen Höhenflügen Genets und dem eigentlichen narrativen Gehalt des Romans.
Von der Erzählung eines Matrosen, der sich auf der Suche nach Wahrhaftigkeit durch Mord, Drogenschmuggel und Verrat ins Ausgestoßenendasein stürzt, bleiben bei Fassbinder nur einzelne Stationen und Sätze, aber kein erzählerischer Bogen. Der Deutsche spöttelt angesichts der unablässigen Umwälzungen des Franzosen, der das Große im Kleinen, das Reine im Schmutzigen, die Schönheit im Verfall sucht. Querelle wurde dazu noch auf Englisch gedreht, eine Sprache, die Fassbinder nicht sehr gut beherrschte und die sich so schon fast zwangsläufig zwischen Regie und Text schieben musste. Aber Fassbinders Spott ist gedämpft, denn unter den Drag- und Fetischkostümen der Figuren, unter der Pappmachéstruktur der antinaturalistischen Sets brodelt die echte Sehnsucht nach einer für ihn adäquaten filmischen Darstellung homosexueller Liebe.
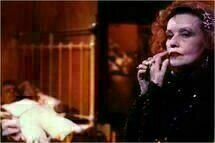
Nirgendwo offenbart sich diese liebevolle, spöttische Distanz wohl deutlicher als in den halluzinatorischen, hochgradig artifiziellen Bilderwelten von Querelle. Und auch hier taumelt der Film zwischen Gegensätzen: Manche Bilder sind weich, als habe Kameramann Xaver Schwarzenberger Vaseline auf die Linse geschmiert, doch nebenan ragen meterhohe gemauerte Penisstatuen in den papiernen Himmel. Der gesamte Film kleidet sich in Drag: Männer spielen Frauenrollen, schwitzende Matrosen reiben einander die Rücken und wickeln Taue auf, ein Messerkampf wird zu einer Mischung aus Balztanz und Duell. Querelle ist Queer Cinema, bevor es das Label überhaupt gab.
Und überall Blicke, die zugleich lüstern und verachtend sind; Augen, aus denen Begehren ebenso dringt wie Rivalität. Fassbinders Hafenstadt ist ein fernes Echo der Hotellobby aus Warnung vor einer heiligen Nutte (1970): eine abgeschlossene, bis zum Bersten erotisierte Welt, in der Gewalt und Zärtlichkeit unablässig zirkulieren, mal zu amourösen, mal zu handgreiflichen Begegnungen führen. Doch das Füllhorn von Liebe und Hass ist hier nicht länger zwischen den Geschlechtern aufgeteilt, jeder Blickwechsel umfasst die ganze Widersprüchlichkeit einer allein männlichen Sehnsucht. Frauen kommen mit Ausnahme von Puffmutter Lysiane (Jeanne Moreau) nie zu Wort, und die trällert zuletzt in endlosen Wiederholungen den Vers Oscar Wildes: „Each man kills the thing he loves ...“
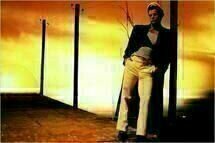
Querelle erlangt zu keinem Zeitpunkt ästhetische Geschlossenheit. Der theatralische Grundmodus reibt sich an der stoischen Regungslosigkeit der Gesichter. Die teils von Voice-over, teils durch Textbildschirme eingelagerten Sprachkaskaden Genets schweben in anderen Sphären als die übervoll ausgestatteten Bilderwelten. Querelle frustriert jedes Bedürfnis nach schlüssiger Reflexion und vollendeter Form, er zerdehnt Nichtigkeiten ins Unermessliche und kanzelt Morde als vernachlässigbare Episoden ab. Was also soll man mit einem solchen Film anfangen?
Vielleicht ist es ein einziges Bild, ein kurzer Moment, in dem Querelle all seine Zänke und Selbstverstümmelungen, vielleicht auch all die Triebe seines Regisseurs transzendiert und in der sich dieser filmische Trümmerhaufen zusammenfügt. Als Querelle vom bärenstarken Barmann Nono (Günther Kaufmann) entjungfert wird, in einer Szene, die Widerwille und lustvolle Hingabe ununterscheidbar werden lässt, da hält Kaufmann, die große, tragische Liebe Fassbinders, vor der Penetration kurz inne. In einer aus schräger Untersicht gefilmten Großaufnahme drückt er ganz langsam einen großen Ballen Spucke zwischen den Lippen hervor. Klar, er spuckt auf den vornübergebeugten Querelle, aber zugleich will er das Kommende erleichtern. Dieses bisschen Körpersaft, im weichgezeichneten Licht schillernd, ist der Tropfen, der Fassbinder mit Genet, die seinen Film mit sich selbst aussöhnt. Denn wo die allzu gelackten Bilder von Querelle oftmals Genets Verehrung des wirklichen, physischen Schmutzes vermissen lassen, da hat diese eine Einstellung mit etwas Rotze alle Kraft des poetischen Widerspruchs, jene nur in der Kunst erreichbare Einheit von Schönheit und Ekel, die diesen Film als Ganzes auszeichnet und ihn so einzigartig und unvergesslich macht.
Neue Kritiken

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Die Spalte
Trailer zu „Querelle“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (7 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.














