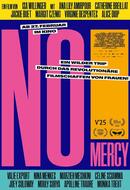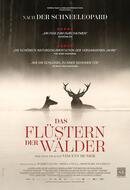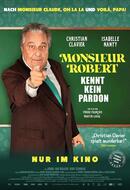Paris, Paris - Monsieur Pigoil auf dem Weg zum Glück – Kritik
Nach Die Kinder des Monsieur Mathieu bringt Christophe Barratier erneut nostalgisches Wohlfühlkino auf die Leinwand. Diesmal mit Faschisten und nur einem niedlichen Kind.

Gleich zu Beginn zeigt eine Großaufnahme Gérard Jugnots verdutztes Gesicht. In diesem Bild spiegelt sich fast der gesamte Film. Es ist die Konzeption eines Kinos, das sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner des größtmöglichen Publikums konzentriert: In diesem Fall ist es die Bereitschaft über das komödiantische Gesicht Jugnots zu lachen, auch wenn es eigentlich nicht viel zu lachen gibt. Wenig später setzt die für Paris-Filme obligatorische Akkordeon-Musik ein.
Paris, Paris - Monsieur Pigoil auf dem Weg zum Glück (Faubourg 36) verkörpert eine Vorstellung von Kino, die das gemeinschaftsstiftende Moment hervorhebt. Hierin ist er dem größten französischen Kinoerfolg jemals, dem kürzlich in Deutschland gestarteten Willkommen bei den Sch’tis (Bienvenue chez les Ch’tis), nicht unähnlich. Auf der Handlungsebene ist Barratiers Intention von Anfang an dominant: Eine liebenswürdige, verschworene aber häufig zerstrittene Variété-Künstler-Truppe rund um Pigoil (Jugnot) wird vom Immobilienmagnaten Galapiat (Bernard-Pierre Donnadieu) auf die Straße geworfen. Hauptkampf des Films ist die Rückgewinnung der Bühne, die für Pigoil mit einem persönlichen Antrieb verbunden ist: Solang er keine feste Arbeit hat, verliert er das Sorgerecht für seinen Sohn.

Mit Pigoils Sohn kommt Paris, Paris schon recht bald der Niedlichkeitsfaktor abhanden, um von da an zwischen etlichen Nebenpfaden zu mäandern, bevor der Film zum Schluss in einer fantastischen Gemeinschaftsbildung zum Musical wird, an dem letztlich alle – ob Sänger oder nicht – teilnehmen. Die Geschichten, in die sich Barratiers Arbeit zerfasert, zu beschreiben, würde jegliche Besprechung sprengen. Sie umfassen eine Vielzahl kleiner Konflikte rund um den sozialistischen Gewerkschafts-Anführer Milou (Clovis Cornillac), seiner opportunistischen Angebeteten Douce (Nora Arnezeder), dem feigen Jacky (Kad Merad) und den bereits genannten Antagonisten Pigoil und Galapiat.
Paris, Paris vermag es ganz nebenbei seine Schauwerte auszustellen – Stichwort entfesselte Kamera – und verbindet dies mit dem kruden Versuch einer aseptisierten Vergangenheitsdarstellung voll lächerlich-harmloser Charaktere brauner und roter Gesinnung. Dass der Film im Gegensatz zu Die Kinder des Monsieur Mathieu (Les choristes) kein Zentrum findet und nicht einen der Konflikte ausreichend überzeugend unterfüttert, führt nach und nach zur Gleichgültigkeit gegenüber den Figuren. Selbst mit einem bedingungslosen Willen, sich unterhalten zu fühlen, ist dem nur schwerlich beizukommen. Dafür müsste man allerdings auch ausblenden können, welch beschönigenden und sentimentalen Blick der Film auf das Leben im Paris der 1930er Jahre und den florierenden Faschismus wirft.
Paris, Paris beginnt im Jahre 1936 und endet 1945. Die neun Jahre dazwischen lässt er aus. Wie passend.
Neue Kritiken

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother

The Day She Returns

Prénoms
Trailer zu „Paris, Paris - Monsieur Pigoil auf dem Weg zum Glück“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (19 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.