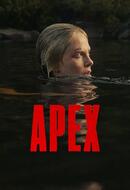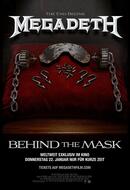Outside Noise – Kritik
Neu auf MUBI: Rumliegen, auf Hauspartys abhängen, über Masterarbeiten sprechen. Ted Fendts Kino erzählt, was sonst so gut wie nie erzählt wird. Die drei Frauen in Outside Noise sprechen dabei mehr von anderen Dingen als von sich selbst.

Es gibt zeitgenössisch nur noch wenige Filmemacher*innen, die auf analogem Material drehen und ihre Filme auch so aufgeführt wissen wollen. Abgesehen von Festivaleinsätzen ist das distributionstechnisch ja auch eine Katastrophe, ein Luxus, der sich weitgehend auf Roadshow-Specials von Quentin Tarantino, Christopher Nolan und Co. zu beschränken scheint. Im Low-Budget-Bereich – der narrationsscheue und mit regulären Kinoauswertungen ohnehin nicht bedachte Experimentalfilm ist hier wohl eine Ausnahme – sind es sogar sehr wenige, die das noch durchziehen. Ted Fendt (*1989), ein in der New Yorker Repertoire-Kinolandschaft sozialisierter Filmemacher, Filmvorführer, Übersetzer und freier Autor ist einer von ihnen.

Wie schon das Langfilmdebüt Short Stay (2016) und der auf der Berlinale uraufgeführte Classical Period (2018) ist sein neuer Outside Noise (2021) ein gut einstündiger Analogfilm geworden. Während Classical Period sowohl auf 16mm gedreht als auch projiziert wurde, kehrt Fendts Dritter technisch zum Debüt zurück: Es handelt sich um ein 35mm-Blowup eines 16mm-Films, denn Dreh- und Vorführmaterial sind (siehe auch die immer mal wieder anzutreffenden analog gedrehten, aber digital vertriebenen Kinofilme) zwei Paar Schuhe. In heute kaum noch gezeigten 1:1.66-Bildkadern ist so stets eine grobe Filmkörnung sichtbar, und wie Tageslicht in Innenräume einfällt, dort das Interieur und die Körper in sanften Abstufungen modelliert, wird uns auf solche Weise eine Digitalprojektion nie zeigen können.
On & Off

Abseits der Kontinuitäten mit Fendts bisherigem Œuvre – der heutzutage unüblichen Spieldauer und eben der Analogfilmpräferenz –, schlägt Outside Noise auch neue Wege ein. Es ist sein erster, fast ausschließlich auf Deutsch gedrehter Film, der statt der vertraut wirkenden Schauplätze eines urbanen East-Coast-Amerikas hier nun auf den ersten, konventionell verstellten Blick gar nicht so „bildwürdig“ wirkende Straßenecken und Parkanlagen in Berlin und Wien präsentiert. Das heißt, wenn der Film einmal gerade nicht in Innenräumen spielt. Hier wie dort stehen dieses Mal weibliche Figuren im Fokus – Daniela, Mia und Natasha heißen sie wie ihre Darstellerinnen (Daniela Zahlner, Mia Sellmann und Natascha Manthe) –, während die eher unangenehmen Typen, die es schon in seinen vorangegangenen Filmen gab, diesmal nur die Ränder bevölkern.
Apropos Ränder: Outside Noise legt in Sachen Schauplatz-Hermetik gegenüber den ersten beiden, auch schon „kleinen“ Filmen noch einmal eine Schippe drauf; wir folgen meist lediglich drei Figuren, die zusammen Zeit verbringen. Die Mikrokosmen in Fendts Filmwelt – in Short Stay eine tragikomisch entfremdete WG-Hölle, in Classical Period ein asketischer Lesekreis zu Dantes Commedia – sind dabei so abgesteckt, dass sie das (gesellschaftliche) Außen, wenn überhaupt, dann ungezwungen „im Vorbeigehen“ aufschnappen.

Im Viennale-Programmtext zu Outside Noise ist gar davon die Rede, dass das Setting die pandemiebedingte Lockdown-Erfahrung spiegle. Das ist vielleicht etwas zu interpretationswütig, aber dass wir es mit privatisierten Kinoblicken zu tun haben, stimmt. In Outside Noise kann man das Verhältnis von Innen und Außen, das schon der Titel irgendwie andeutet, als das erzählerische wie ästhetische Grundprinzip verstehen. Es fehlt zwar gänzlich der Lärm, aber einen Geräuschpegel gibt es in den von Naturlicht durchmessenen Innenräumen (sehr schön auch die Details von Zimmerpflanzen) stets. Er verbindet die Frauen mit der Außenwelt, selbst dann, wenn sie sich manchmal wie Monaden fühlen.
Äußerliches Kino

Outside Noise war finanziell wohl überhaupt nur zu realisieren, indem Fendts eigenes Umfeld in einen (teil-)fiktionalisierten Rahmen verfrachtet wurde. Dieser enthält in erster Linie Alltäglichkeiten und gibt uns nie vor, wie wir uns beim Betrachten fühlen sollen; keine Filmmusik, kein stimmungsvolles Filmlicht, keine Kniffe des Spannungskinos. Es ist ein unaufgeregtes, filmisch ebenso präzises wie distanziertes Porträt von Menschen in Fendts Alter, die in ihren Altbauwohnungen so über die Runden kommen, sich gegenseitig besuchen, Spaziergänge machen, weder Glück noch Trauer empfinden.
Sie sind in einer liminalen Phase. So wird es zumindest einmal in einer langen, statischen und dabei wie so oft schnittlosen Dialogszene genannt. Mia erzählt Daniela auf der Couch sitzend von ihrer Masterarbeit. Sie fasst dafür eine ethnologische Theorie zusammen, die den besagten Schwellenzustand behandelt, bei dem sich Individuen zwischen unterschiedlichen Sozialordnungen befinden. Als Daniela das hört, wendet sie es sogleich auf sich und das eigene langsame, an Fixpunkten arme Leben an. Sowieso hört sie ihrer Freundin aufmerksam zu, fragt immer wieder nach, interessiert sich für das, was Mia seit geraumer Zeit tut. Bei so einer Abschlussarbeit ist man ja fast nur bei sich. Und so will man sich mitteilen, sich selbst auch die eigenen Gedanken referieren, um auszuloten, ob’s überhaupt Sinn macht. Mia gerät dabei manchmal ins Stocken, sucht Worte, guckt konzentriert ins Leere. Man kann ihr beim Denken zusehen.

Der Akt des Sprechens ist, ähnlich wie im Kino von Straub-Huillet, hier schon ein Ereignis für sich. In Outside Noise erzählt er viel über die Figuren, die ohnehin häufiger von anderen Dingen sprechen als von sich selbst. Oder besser: Sie sprechen anhand anderer Dinge über sich. Denn obwohl wir Freundinnen begleiten, die sich ja immerhin über weite Distanzen hinweg besuchen (Natasha ist eher Anhängsel, Daniela ist sie nicht ganz grün), gibt es zwischen ihnen anscheinend die Scheu, abseits der gemeinsam geteilten Schlafstörung wirklich Intimes preiszugeben. Auch hier laufen das Äußere und Innere nebeneinander her.
Aufregende Alltäglichkeit

Bei diesen zwischenmenschlichen Situationen steuert nichts auf ein Finale zu. Es ist ein Kino, dem die Pointe fehlt. Und im Übrigen will auch die Formsprache bei aller durchkalkulierten Präzision auf keine selbstzweckhafte Ästhetisierung der porträtierten Welt hinaus. Sie will nicht die „ephemere Schönheit“ des bürgerlichen Alltags retten, wie es beim Merkwürdigen Kätzchen (Ramon Zürcher, 2013) der Fall war. Outside Noise sieht schlicht so schön aus, wie Filme der 70er häufig schön aussahen, was heute, wertfrei festgestellt, nicht mehr die Regel ist.

Was Fendts Kino dabei nicht rückwärtsgewandt, sondern eigenständig macht, ist, dass das, was es erzählt, sonst so gut wie nie erzählt wird. Masterarbeitsthesen, bei quatschigen Hauspartys vorbeisehen, rumliegen. Fendt versucht, Dinge, die für gar nicht so wenige relevant sind, dem Kino, das reflexartig bigger than life sein will, erst einmal zu erschließen. Und auch ein bisschen Ironie gibt es: Am Ende des Films trifft sich die Wienerin Daniela mit einer Bekannten. Diese erzählt eine spektakuläre Anekdote aus dem Leben einer Frau, mit der sie bekannt ist und die gleich um die Ecke wohnt. Ob sie sie nicht besuchen wollen, man lese doch ansonsten nur von solchen Menschen.
Den Film kann man bei MUBI streamen.
Der Text ist ursprünglich am 06.01.2022 erschienen.
Neue Kritiken

Winter in Sokcho

Die Spalte

Hamnet

Die Stimme von Hind Rajab
Trailer zu „Outside Noise“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (9 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.