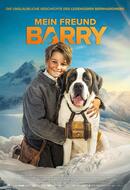Pferde stehlen – Kritik
Ein alter Mann hält Rückschau auf einen Sommer seiner Kindheit in Schweden. In einem überdrehten Sturm aus Bildern, Klängen und Musik sträubt sich Pferde stehlen gegen die Vermutung, dass diese Zeit kaum Nachwirkungen hatte.

Das Ereignis, das den alternden Trond Sander nach 32 Jahren in Schweden zurück in seine norwegische Heimat treibt, ist natürlich in erster Linie eine Tragödie. Doch in einem gewissen Sinn ist der Tod seiner Frau bei einem Autounfall, bei dem er selbst am Steuer saß, auch eine Art Initiation: Trond ist nun einer jener Menschen, die Verantwortung für den Tod eines anderen tragen. Diese grundlegende Wesensverwandlung wirft Trond zurück in die Welt seiner Kindheit, genauer in die Erinnerung an einen Sommer, der offenbar für sein ganzes weiteres Leben prägend war. Denn in jener Siedlung in der norwegischen Wildnis, in die sein Vater während der Kriegsjahre gezogen war und in der Trond ihn im Jahr 1948 für einige Monate besucht, scheinen sich die Menschen in zwei Arten einteilen zu lassen: jene, die früh sterben, und jene, die das in der oder anderen Form verschuldet haben. Die Figuren in Hans Petter Molands Film Out Stealing Horses stehen somit ständig vor der Frage, ob sie den Platz, der ihnen von den äußeren Umständen ihres Lebens zugewiesen wurde, auch tatsächlich eingenommen haben – oder ob sie vielmehr andere von ihrem Platz verdrängt haben.

Auch die Ereignisse jenes Sommers 1948 kreisen, wie Tronds einsames Exil in der Gegenwart des Jahres 1999, um einen tragischen Unfall: Beim Spielen bekommt der junge Lars ein geladenes Gewehr in die Hand – und erschießt aus Versehen seinen Zwillingsbruder. Ebendiesen Lars, den er seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat, trifft Trond nun in seiner winterlichen Einöde wieder. Beide können nicht wissen, wie der andere nach all der Zeit aussieht, und doch erkennen sie sich auf Anhieb wieder – nicht an ihrem Äußeren, sondern an der synchronen Schuld, mit der nunmehr beide leben. Nach diesem Treffen wechselt der Film mit dem Gestus epischer Breite immer wieder hin und her zwischen den stillen Zusammenkünften der zwei gealterten Männer und den wenigen Wochen 50 Jahre davor, die sie zwar nicht eigentlich gemeinsam, aber zumindest in unmittelbarer räumlicher Nähe voneinander verbrachten.
Eine Vergangenheit, die keine Wunden hinterlässt

Out Stealing Horses präsentiert sich somit als ein forschender Rückblick: In der Endphase seines Lebens durchkämmt Trond jene Momente, von denen er meint, dass sie dessen Verlauf entscheidend bestimmt haben. Das Grundproblem von Out Stealing Horses ist jedoch, dass in den Ereignissen jenes vorgeblich so schicksalshaften Sommers nie eine derart durchdringende, lebensbestimmende Wirkungsmacht erkennbar wird. So entwickelt sich die permanente physische Bedrohung, die von der Wald- und Holzfällerarbeit des Vaters ausgeht – das Kippen der Baumstämme, das Schärfen einer Sense, das mächtige Rollen der Rundhölzer –, nie tatsächlich zu einer Erkundung menschlicher Verletzlichkeit. Sie bleibt bloß ein wuchtiges Schauspiel, von dem man sich nicht vorstellen kann, dass es in dem Erleben des Heranwachsenden irgendwelche Wunden hinterlässt. Auf ähnliche Art und Weise bleibt auch die Figur des Vaters hinter den stets pittoresk ins Gesicht geschmierten Schlieren aus Schweiß und Erde gänzlich unbestimmt. Zwar werden ihm ein paar eindringliche Momente zugestanden, etwa wenn er mit nackten Händen in einen Brennnesselstrauch greift, den er zuvor angstvoll gemieden hat, und dabei die Augen mit demütigender Ruhe auf seinen Sohn gerichtet hält. Aber diese Demütigung hat keinerlei Nachwirkung, weder im Verhalten noch in den Gedanken der Figuren – die Szene bleibt, wie die meisten anderen auch, nur ein knappes Protokoll, mit dem ein bestimmter Aspekt der Vergangenheit dann auch abgehakt ist.
Das verzweifelte Ringen um Intensität

Auch das Gesicht des alternden Trond bietet wenig mehr als das Bild einer ausdruckslosen Innerlichkeit. So scheint sein Blick zurück in die Vergangenheit nicht so sehr aus einem so dynamischen Prinzip wie dem eines aktiven Interesses heraus zu geschehen, sondern nur aus einer umfassenden Erschöpfung: Vielleicht denkt er gar nicht an den Moment zurück, der sein Leben geformt hat, sondern nur an jene Zeit, in der eine solche Formung vielleicht noch möglich gewesen wäre – sich aber dann doch nicht eingestellt hat. Die Eigenschaftslosigkeit des Alters fände so seine Entsprechung in der Formlosigkeit der eigenen Jugend.

Nur: Gegen diese implizite Schlussfolgerung sträubt sich der Film mit ganzer inszenatorischer Gewalt. Er selbst scheint es nicht akzeptieren zu können, dass die äußerlich doch so dramatischen Ereignisse, aus denen sich der geschilderte Jugendsommer zusammensetzt, keinerlei längerfristige Bedeutsamkeit entfalten sollten. Immer wieder vermengt er dann einzelne Handlungen – eine sachte Umarmung, das Schlagen einer Axt, den stummen Konkurrenzkampf zwischen dem Vater und einem Nebenbuhler – zu einem überdrehten Sturm an Bildern, Klängen und peitschender Musik. Und wenn dadurch noch kein ausreichendes Maß an Intensität entstanden ist, muss sich ein im Takt zur Musik aufgrollendes Gewitterdonnern dazugesellen. In diesen Momenten merkt man, wie eng das Korsett ist, das sich Out Stealing Horses mit seiner romanhaften Struktur einer Ursachenforschung und Lebensdeutung selbst umgelegt hat – und wie der Film dadurch fast zwanghaft seinen Szenen die Luft abschnürt.
Neue Kritiken

No Bears

Scarlet

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother
Trailer zu „Pferde stehlen“



Trailer ansehen (3)
Bilder




zur Galerie (7 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.