Öndög – Kritik
Zu Gast in den Verhältnissen, die das Leben formen. Wang Quan’an entspinnt in Öndög anhand eines Leichenfunds in der mongolischen Steppe ein Geflecht aus poetischen und dokumentarischen Bildern.

Man kann das Wort „mongolisch“ kaum denken, ohne dass sich automatisch das Wort „Steppe“ dazugesellt. An dieser elementaren, beinahe stereotypen Verbundenheit zwischen dem Land und der Kargheit, Einförmigkeit und vor allem Flachheit seines Territoriums will auch Öndög von Wang Quan’an nicht rütteln. Die mongolische Landschaft tritt in den Panoramabildern des Films als eine abstrakte Fläche in Erscheinung, die keinerlei Koordinaten liefert, keinerlei feste Ortsbestimmung erlaubt und auch keinerlei Strukturen enthält, an denen sich ablesen ließe, in wie weiter Ferne der breite Horizont nun liegt. Der Boden, auf dem sich die Figuren in Wangs Film bewegen, scheint sich unterschiedslos in alle Richtungen bis in die Unendlichkeit fortzusetzen – und so wie der Raum nicht mehr als ein festes Gerüst erscheint, so scheint auch die Realität kein starres und endgültiges Gebilde mehr zu sein. Die Menschen in Öndög leben zwar innerhalb von sozialen und kulturellen Verhältnissen, doch sind sie in diesen Verhältnissen stets wie zu Gast.
Zwei Welten, die sich dieselbe Landschaft teilen müssen

In dieser Welt, die zwischen nüchterner Alltäglichkeit und poetischer Unwirklichkeit hin und her flimmert, ist nun plötzlich eine Leiche aufgetaucht: Der leblose und unbekleidete Körper einer Frau liegt in den zitternden Grashalmen der Steppe. Ein junger Polizist wird zur Bewachung der Leiche abgestellt, und eine gerade in der Gegend weilende Hirtin wird zu seinem Schutz abkommandiert, da sie als Einzige ortskundig und bewaffnet ist. Der Einbruch des Todes wird in Öndög so zum Anlass, zwei gegensätzliche Lebensweisen aufeinandertreffen zu lassen, mal misstrauisch, mal unerwartet innig: die der Sesshaften und die der Nomaden. Das Verhältnis dieser zwei Ordnungen bildet das instabile Zentrum des Films: Hier umschlingen sich zwei Welten, die in ihren Regeln und Gewohnheiten unvereinbar sind und die doch nicht ohne einander bestehen können.

Das Bild zweier Welten, die sich dieselbe Landschaft teilen, entwickelt Öndög als eine Abfolge weitgehend eigenständiger und voneinander losgelöster Szenen. Dabei wechselt der Film zwischen einem beobachtenden, forschenden Gestus und einer fast exaltierten Abstraktheit hin und her. Doch sind es in der Regel die rein registrierenden Bilder, die ob ihrer Detailfülle eine mehrdeutige und faszinierende Wirkung entfalten: die Hirtin, sie sich einen Mantel umlegt, in bedächtigen Handgriffen den Gürtel umbindet und schließlich penibel die verbliebenen Falten glattstreicht, oder der hastig zu Hilfe gerufene Nachbar, der nach der Geburt eines Kalbes das ölige Fruchtwasser von seinen Händen wischt. Daneben haben die lyrischen Einschübe oft etwas Angestrengtes, als sollte den Bildern eine Bedeutsamkeit abgepresst werden, die sie aus ihrer tatsächlichen Gestalt heraus nicht entfalten – etwa wenn der junge Polizist allein in der Nacht mit seinem hell leuchtenden Handy tanzt, dessen kleiner Lautsprecher Elvis Presleys „Love Me Tender“ von sich gibt. In diesen Momenten vertraut der Film allzu sehr auf die traumartige Gesichtslosigkeit seiner Landschaft: von jeder größeren Struktur losgemacht, fliegen die Szenen in Öndög dann nur unentschlossen durch die Gegend, wie halb aufgeblasene Ballone.
Neue Kritiken

No Bears

Scarlet

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother
Trailer zu „Öndög“


Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (5 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
PL
Der Familienname des Regisseurs ist Wang, nicht Quan'an.
Michael
Danke für den Hinweis. Ist korrigiert.


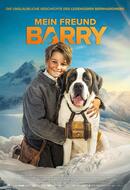





2 Kommentare