Mr. Turner – Meister des Lichts – Kritik
Mr. Turner geht es mehr um den Mister als um den Künstler: Mike Leigh macht ein Biopic ohne Heldenverehrung.

Der britische Meistermaler Joseph Mallord William Turner sollte der Nachwelt doch eigentlich über seine Bilder erhalten bleiben, vor allem über seine zwischen Ocker, Ultramarin und Zinnober zerfließenden Himmelspanoramen. Aber jetzt hat Mike Leigh, der poetische Erretter des Kitchen-Sink-Naturalismus, einen Film über ihn gedreht und seinen Lieblingsschauspieler Timothy Spall für die Hauptrolle gecastet. Und was ist passiert: Von nun an wird uns jeder Huster an Turner erinnern.
Ehrerbietung streng verboten

Mr. Turner spielt Leben und Kunst gegeneinander aus. Er pickt sich für seine erdenden, prosaischen Episoden just jene späten Jahre aus Turners Biografie heraus, in denen der immer ungegenständlicher arbeitende „Lichtmaler“ seine Gemälde zunehmend ins Natürlich-Erhabene stieß. Krass erscheint da der Widerspruch, wenn Timothy Spall vornübergebeugt seine schweren Hüften ächzend und grunzend durch enge Korridore presst. Wie Turners Bilder ihre Schiffe, Lokomotiven oder Seemonster hinter dicht aufgetragenen Farbverläufen nahezu verschwinden lassen, so begräbt Spalls nonverbales Geschnaufe jedes (ohnehin Leigh-typisch mit dickstem Lower-Class-Dialekt betonte) Wort bald unter sich. Die von Turner malerisch heraufbeschworene, schreckensvolle Natur: So grandios sie sich über die Seeszenen und flandrischen Landschaften ergießt, so penetrant rückt sie dem einzelnen kleinen Menschen auf den schwächlichen Leib.
Auf diese Weise entsteht erst einmal eine enorme Distanz zwischen Person und Werk, was Mr. Turner zugleich meilenweit von der unterwürfig-ehrerbietenden Haltung vieler Biopics entfernt. Leigh verbietet sich auch eine Glorifizierung der Werke selbst: Hier gibt es keine andächtig jeden Pinselstrich entlang gleitende Kamera, keine hymnisch die Kunsterfahrung erzwingende Musik. Stattdessen rotzt Spall in der National Gallery auf sein eigenes Bild, stapelt die in Akkordarbeit rausgehauenen Leinwände auf dem Boden seines heimischen Privatmuseums, kritzelt wie irre in seinem Skizzenbuch herum. Kunstschaffen ist hier zuallererst Arbeit, fordert körperlichen Einsatz.
Der Künstler steht dem Tier näher als der Mensch

Nur vereinzelt und in herausgehobenen Momenten steuert Mr. Turner ästhetische Erfahrungen im engeren Sinne an, und niemals geschieht das vermittels der Gemälde Turners, die immer nur kurz, fast beiläufig von der Kamera gestreift werden. Stattdessen forscht Leigh nach den realweltlichen Inspirationsquellen des Malers. Es sind kurze, meditative Augenblicke inmitten ordinärer Alltagsszenen, wenn beispielsweise das Herannahen einer Dampflokomotive mit fast Hauptmann'scher Ehrfurcht gefilmt wird oder sich Turners Schattenriss gegen die in Sonnenuntergangsorange getauchten holländischen Ebenen abzeichnet.
Aber das Gros von Mr. Turner ist trotz der Period-Picture-Kulissen nicht allzu weit entfernt von Detailbeobachtungen britischen Unterklasselebens wie Ordinary Life (2002, ebenfalls mit Spall in der Hauptrolle). Turner selbst kam aus bescheidenen Verhältnissen, und so macht sich Leigh einen Spaß daraus, seine nur widerwillig und unter gequältem Geächze vorgetragenen Bemerkungen zu seinen Werken mit den Elogen hochwohlgeborener Kunstschwärmer wie John Ruskin (Joshua McGuire) zu kontrastieren. „A slave ship, dead bodies swimming in the sea, apocalyptic lightning“, so beschreibt Turner eines seiner berühmtesten Gemälde. „I am delighted to be greeted every morning by this masterpiece of atmosphere hanging above my chimney“, so ungefähr sieht es der Kritiker. Davor war er noch ganz begeistert von der dezentralen Positionierung der untergehenden Sonne. In solchen Momenten ist Mr. Turner, auch dank sehr konzentrierter und wohlarrangierter Arrangements des steifen Upper-Class-Lebens, gar nicht weit entfernt von Kubricks Barry Lyndon (1975).

Wenn sich das Menschenwesen dank seiner von Geisteskraft ersonnenen ehernen Kulturgüter maximal weit vom Tier entfernt glaubt, beugt Leigh diese Linie zu einem Kreisschluss. Auch wenn wir wissen, dass große Genies im wirklichen Leben gern große Spinner waren, ist es doch bemerkenswert, wie heftig Mr. Turner auf Körperlichkeit und animalische Regungen insistiert. Sexualität beispielsweise ist immer eruptiv und ungestüm: Die Haushälterin (Dorothy Atkinson) wird rüde von hinten am Bücherregal genommen, die alternde Witwe (Marion Bailey) grob betatscht. Diese Nähe von Mensch und Tier ist sinnfällig, wenn Turner Senior (Paul Jesson), der Barbier, seinen Sohn und einen Schweinskopf mit der gleichen Andacht rasiert. Überhaupt sind die Szenen zwischen den sich innig liebenden, einander fast mimetisch kopierenden Turners toll: Wie zwei evolutionär im Menschenaffenstadium steckengebliebene Bestien umkreisen und umkeuchen sie einander, ihr beider Lungenleiden wird ihnen auch letztlich das Leben kosten.
Eigentlich geht es um die Nebenfiguren

Was Leighs Schaffen seit jeher auszeichnet, ist sein gewöhnliche Hierarchien der Macht, der sozialen Bedeutung, der ästhetischen Wertschätzungen verschiebender Blick. Am zartesten verfahren seine Filme meist mit den randständigen Figuren, den Ausgebremsten und Beiseitegestellten. Selbst in Filmen, in deren Zentrum scheinbar sicher im Leben verankerte, anerkannte Charaktere stehen, offenbaren die Nebenfiguren bei näherem Hinschauen hochkomplexe, faszinierende, detailliert ausgearbeitete Persönlichkeiten (ganz prominent beispielsweise in Another Year von 2011). Man spürt schlicht, dass Leigh in seinen ungescripteten, präzis improvisierten Filmen jeder Figur mit der gleichen Achtsamkeit begegnet. Im Falle von Mr. Turner sind es denn auch die Frauenrollen, die nur auf den ersten Blick von der schieren physischen Präsenz der ruhmschwangeren Künstlerperson in ihrer Mitte zerdrückt werden.

Zum Beispiel Turners Haushälterin/Gelegenheitsgeliebte, die er nie mit dem Vornamen anspricht: Über die Laufzeit des Filmes wird ihre Haut nach und nach von einem bösen, krebsroten Ausschlag bedeckt, aber nie sagt sie etwas, nie sagt er etwas. Nur wir Zuschauer leiden im Geheimen mit dieser stillen, von Dorothy Atkinson zärtlich verschroben gespielten, unbedeutenden Dame im Leben des ach so bedeutenden Künstlers. Ihr, die in den charismatischen Grobian Turner heimlich verliebt ist, gebührt denn auch die letzte Szene, als sie nach dessen Tod alleine und schluchzend zwischen aneinander gestapelten Leinwänden steht. Was da im Kleinen geschieht, vollzieht Mr. Turner im Großen nach: Er verschiebt die eingeschliffenen Beurteilungsschablonen dafür, was wichtig und was unwichtig zu sein hat, er lässt schwelgerische Ahnungen über die Untiefen einer Genieseele für ordinäre Beobachtungen eines wahrscheinlichen Alltags links liegen und schafft es so, dass man bei William Turner von nun an nicht mehr nur oder zuerst an die Tate Gallery denkt, sondern auch und vielleicht an Vandas Husten der Missachteten (In Vanda’s Room, Pedro Costa, 2000).
Neue Kritiken

Ungeduld des Herzens

Melania

Primate

Send Help
Trailer zu „Mr. Turner – Meister des Lichts“



Trailer ansehen (3)
Bilder

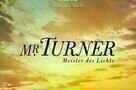


zur Galerie (12 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.















