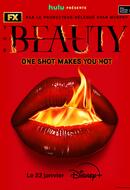Motel – Kritik
Luke Wilson und Kate Beckinsale in der Falle: Ihr Motelzimmer entpuppt sich als Schauplatz für ein Horrorvideo, in dem sie vor laufender Kamera ermordet werden sollen. In seinem zweiten Spielfilm versucht sich Regisseur Nimród Antal in klassischem Genrekino.

Als Zuschauer dieses Films fragt man sich gelegentlich, wie gut sich seine Hauptfiguren wohl mit Horrorfilmen auskennen. Die erste Vermutung ist: Überhaupt nicht – sonst wüssten sie, was seit 1960 jeder weiß: Dass man um abgelegene Motels einen großen Bogen machen sollte. Dass man spätestens dann Reißaus nehmen sollte, wenn einem der verschrobene Kauz an der Rezeption mitteilt, man sei der einzige Gast heute Nacht. Und dann noch die ausgestopften Vögel auf dem Tresen ... Doch selbst wenn man, übermüdet wie man ist, all diese meterbreiten Zaunpfähle übersieht: Wie vertrauenerweckend ist ein Concierge, der sich im Nebenzimmer offenbar gerade mit Gewaltvideos vergnügt hat („Sorry, hier draußen wird’s nachts oft langweilig“) und nun zur Übernachtung die „Honeymoon Suite“ empfiehlt, mit dem Versprechen, die habe ein paar Extra-Überraschungen parat? Doch trotz alledem: David (Luke Wilson) und Amy Fox (Kate Beckinsale) bleiben. Ihr Auto ist liegengeblieben, nachdem sie sich heillos verfahren haben – auf einer Nebenstraße, die David, auch dies ein Anfängerfehler, für eine Abkürzung gehalten hat.

Andererseits: So weltfremd, als hätten sie noch nicht einmal Psycho gesehen, wirken die beiden nicht. Und reagiert David nicht zunächst verdächtig abgebrüht, als er in dem Motelzimmer das erste Snuff-Video findet? Vielleicht kennen sie ja die Materie ganz genau. Gut genug, um zu wissen: Es gibt keine bessere Paartherapie als einen gemeinsam durchgestandenen Horrortrip. Die Exposition – ein Paar, dessen Ehe nach dem Tod des gemeinsamen Kindes vor dem Aus steht, gerät auf einer Reise in tödliche Gefahr – ist aus einschlägigen Filmen schließlich bekannt. Vielleicht wählen David und Amy die nächtliche Abzweigung ins Grauen also ganz bewusst – gutgläubig nur in der Hoffnung, dass es ihnen eher ergehen wird wie ihrem Vorgängerpaar aus Todesstille (Dead Calm, 1988) als dem aus Wenn die Gondeln Trauer tragen (Don’t look now, 1974), sprich: dass sie beide lebend aus der Sache herauskommen werden.

Mit der Subtilität und psychologischen Genauigkeit dieser Filme hat Motel allerdings nichts gemein. Die Ausgangssituation des Paares ist hier nur noch kalkulierter Einsatz eines erprobten Standardmotivs, das die für Horrorfilme so notwendige Einfühlung in die Opfer sicherstellen soll. Was ihnen widerfährt, ist dann zwar in der Tat ziemlich heftig: David und Avy entdecken, dass die Snuff-Movies nirgendwo anders gedreht wurden als in ihrem eigenen Motelzimmer. Und die Dreharbeiten für die nächste Folge haben schon begonnen. Doch so schockierend diese Entdeckung auch ist und so drastisch die Ausschnitte aus den Videos anzusehen sind – ein Interesse an der Snuff-Thematik, das über den bloßen Schockeffekt hinausgeht, ist in dem Film nicht zu entdecken. Zu dem Beziehungsdrama steht sie in keinerlei metaphorischem oder sonstigem Bezug. Und Motel wegen der versteckten Kameras und der Film-im-Film-Ebene diskursiv zu durchleuchten scheint müßig. Was schade ist, denn das Thema an sich gäbe dafür einiges her, von Videoüberwachung bis zu Happy Slapping ließen sich hier genügend Anknüpfungspunkte finden. Motel ist einer der Filme, bei denen den Machern selbst das Potenzial ihres Stoffes entgangen ist. „Snuff“ dient ihnen allein als Hauptattraktion einer Geisterbahnfahrt.

Als Geisterbahnfahrt ist Motel aber zumindest kurzweilig. Nicht besonders innovativ, aber flott, kurvenreich, liebevoll ausgestattet – und, das verdient einen besonderen Hinweis, mit einem der schönsten klassischen Vorspänne der letzten Zeit. Dass das abgelegene Motel haargenau so aussieht, wie man es sich vorstellt – unübersichtlich, schmuddelig, Ratten, Kakerlaken und Geheimtunnel inklusive –, dass die Protagonisten genau die Fehler machen, die man von ihnen erwartet – immer im Glauben, genau das Richtige zu tun –, spricht ja nicht gegen eine gute Geisterbahn. Wer sich wie der Rezensent noch immer gerne von den ältesten Tricks erschrecken lässt, wird in Motel auf seine Kosten kommen. Das Grauen wäre zwar ungleich größer, wäre man als Zuschauer der ausweglosen Situation des Pärchens länger ausgeliefert, würde der Film die Angst vor dem unsichtbaren, scheinbar übermächtigen Gegner länger schüren, statt die Killerbande allzu früh als einen Haufen wild gewordener Freaks zu entmystifizieren. Trotzdem, auf einem ganz archaischen Angstlust-Level funktioniert die Sache gut.
Motel wäre also nicht so enttäuschend, hätte ihn nicht ausgerechnet Nimród Antal inszeniert, der 2003 Kontroll gedreht hat, jenen Film, der der Budapester U-Bahn ihren Platz im Weltkino verschafft hat und eines der stilistisch und inhaltlich eigenwilligsten Debüts der letzten Jahre war. Zwar ist tröstlich zu sehen, dass Antal ein solides Genre-Stück wie Motel mit links hinkriegt und auch über die größten Plotlöcher souverän hinweginszenieren kann. Die tiefste Angst aber, die der Film hinterlässt, ist, dass sein Regisseur in Zukunft auf Stangenware abonniert bleiben könnte.
Neue Kritiken

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Die Spalte
Trailer zu „Motel“

Trailer ansehen (1)
Bilder


zur Galerie (2 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.