Mit der Faust in die Welt schlagen – Kritik
In ihrem Spielfilmdebüt − einer Adaption von Lukas Rietzschels Roman "Mit der Faust in die Welt schlagen" – zeigt Regisseurin Constanze Klaue gradlinig und ohne KIischees das Aufwachsen zweier Jungs in einer westernhaften Ost-Landschaft, die zwar Weite suggeriert, doch keine Möglichkeiten bietet.

Anders als Lukas Rietzschels Roman "Mit der Faust in die Welt schlagen" setzt die gleichnamige Verfilmung von Constanze Klaue nicht unmittelbar nach der Jahrtausendwende ein, sondern 2006 − in einem Jahr also, das in der gesamtdeutschen Erinnerung gern als „Sommermärchen“ und „WM im eigenen Land“ glorifiziert wird. Deutschlandfahnen, die bis dahin nur sehr vorsichtig eingesetzt wurden, waren auf einmal überall: verschmiert auf Wangen, geschwenkt im Fahnenmeer, an Autorückspiegeln sowieso. Kurzum: Deutschland war (so die freilich verklärende Geschichtsschreibung) mit der Beihilfe von König Fußball rehabilitiert. Und: geeint.
Das Deutschland in Klaues Debütfilm jedoch ist ein anderes. Fernab von Poldi, Schweini und Klinsi befinden wir uns im fiktiven Ort Bleschwitz in der nicht so fiktiven ostdeutschen Provinz, wo die Brüder Tobi und Philipp zur Schule gehen. Wer den Filmtrailer mitsamt eingeschobenen Buzzwords − „übersehenes Milieu“, ein Film mit „sozialer Sprengkraft“ − gesehen hat, ahnt, wo die Reise hingeht. Während der Vater − einer von vielen ökonomischen „Wendeverlierern“ − mehr schlecht als recht das Eigenheim baut, treiben sich die Burschen herum, wie es Burschen eben so tun. Und orientieren sich nach rechts.
Vielschichtiges Portrait der Verhältnisse
Trotz seiner geradlinigen Erzählweise ist Mit der Faust in die Welt schlagen kein schwarzweißer Thesenfilm, der eine "ostdeutsche Radikalisierung" als A-führt-zu-B-Entwicklung zeichnen würde. Vielmehr setzt das Narrativ auf ein vielschichtiges Portrait der Verhältnisse.

Diese Verhältnisse erzählt der Film in der Konstellation seiner Figuren: Da sind die angesprochenen „Wendeverlierer“ und desillusionierten Alkoholiker Stefan und dessen Ex-Kollege Uwe, die durch die Einswerdung Deutschlands das Nachsehen auf dem Arbeitsmarkt haben. Da sind ihre Frauen − die von Stefan ist frustriert vom wirtschaftlichen Stocken, die von Uwe ist in den Westen übergesiedelt (im realen Ostsachsen kommt auf drei Männer eine Frau). Und da sind Tobi und Philipp, die zwischen all den ökonomischen und sozialen Überforderungen vernachlässigt werden. Außerhalb der (symbolisch erst im Bau begriffenen) eigenen vier Wände gibt es kaum institutionelle Angebote, die ein Zugehörigkeitsgefühl oder auch nur eine Beschäftigung bieten. Die westernhafte Ost-Landschaft suggeriert zwischen ihren Seen und leerstehenden Häusern zwar Weite, aber keine, die mit Möglichkeiten angereichert wäre. Hier gibt es nichts zu tun, niemanden der sich kümmert.
Abwesenheit des Außen
Mit der Faust in die Welt schlagen zeichnet sich nicht zuletzt durch seine Auslassungen aus. Während in Rietzschels Roman recht zu Beginn die Twin-Towers im Fernsehen zusammenbrechen und auf dem Schulhof anschließend über die USA „debattiert“ wird, gibt es in der Verfilmung des Buchs kein Bild des Außen. Der „Westen“ existiert nur als abstraktes Konzept des Anderen, das seine Spuren in Bleschwitz in Gestalt der abwesenden Frau Uwes hinterlässt. Auch „die Polen“, die Stefan als Teilschuldige der prekären Lage auf dem Arbeitsmarkt identifiziert, tauchen im Bild nicht auf. Diese Abwesenheit des Außen, die durch eine Mittendrin-Wackelkamera noch betont wird, fügt sich ein ins oft zitierte Ostdeutschland-Bild einer abgehängten und vergessenen Region. Zwar bilden die Universitätsstädte eine Ausnahme − 2006 fanden in Leipzig, als einziger ostdeutscher Stadt vier Weltmeisterschaftsspiele statt – aber auch diskursiv sind viele Gegenden weitgehend isoliert, und der Leser*innen-Anteil der vermeintlichen Bundeszeitungen FAZ, SZ und Die Zeit kratzt östlich der einstigen Grenze an der vier-Prozent-Hürde. So dringt „die Politik“ auch in Mit der Faust in die Welt schlagen erst im Epilog ein, als die ehemalige Schule von Tobi und Philipp zum Flüchtlingsheim umfunktioniert werden soll. „Merkel stinkt“, steht da an eine Wand geschrieben.

Selbstverständlich kann Mit der Faust in die Welt schlagen die Frage nach den Rechtsruck-Ursprüngen im Gebiet der ehemaligen DDR nicht beantworten. Das ist auch nicht der Anspruch von Klaues Arbeit. Gerade dass sie allzu einfache Antworten umschifft und weder mit Schuldzuschreibungen noch mit auferlegten Ost-Klischees oder populistischen Ressentiments arbeitet, ist ihr hoch anzurechnen. Auch die Radikalisierung Philipps, des älteren der zwei Brüder, vollzieht sich nicht ideologisch, sondern − wenn man dem Film dann doch eine vage These abringen möchte − aus besagtem Potpourri der Verhältnisse heraus: Nach seinem ersten längeren Zusammentreffen mit Ramon (= Teil der lokalen Neonazi-Crew. Ramon bietet Philipp ein Bier an, lässt ihn an seinem Mofa schrauben, sprich: beachtet ihn vergleichsweise wirklich) zeigt der Film Philipp befreit an Rapsfeldern vorbeiradeln, ein kleiner, kindlicher Jubel entspringt seinen Lippen. Die euphorisch anschwellende Filmmusik erklingt in Moll.
Neue Kritiken

Prénoms

Douglas Gordon by Douglas Gordon

If Pigeons Turned to Gold

Don't Come Out
Trailer zu „Mit der Faust in die Welt schlagen“

Trailer ansehen (1)
Bilder



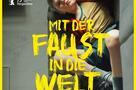
zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.












