Midsommar – Kritik
VoD: Neuer Smart Horror vom Hereditary-Regisseur: In Ari Asters Midsommar mutiert ein Trip ins sonnendurchflutete Schweden zum filmischen Fieberalptraum.

Erst im letzten Jahr ist Ari Aster mit Hereditary – Das Vermächtnis (2018) ein Debüt gelungen, das vielleicht nicht jedermanns Geschmack war, von vielen jedoch als ein Geniestreich gefeiert wurde. Der Film überraschte als Horror, der an die Nieren ging, ohne dabei die übliche Verfahrensmaschinerie anzuwerfen. Die ungewöhnliche und selbstbewusste Filmsprache, das zwischenmenschliche Drama als narratives Fundament und das sich langsam ausbreitende Unheil anstelle einer routinierten Schockparade, hinterließen mächtig Eindruck bei Genre- wie Arthouse-Publikum. Während der Eindruck dieses Films immer noch nachbebt, legt Aster nun mit Midsommar nach.
Absehbar und doch ungewiss
Dieser ist somit einer der meist antizipierten Filme des Jahres und hat zwangsweise mit einer Erwartungshaltung zu kämpfen, die nach derartig großen Erstlingserfolgen auch zum Verhängnis werden kann. Aster begegnet dieser Herausforderung mit einer Verflechtung von Erwartbarem und Unabschätzbarem. Die Story lässt sich deutlicher in vorhandene Erzählmuster einordnen. So ist von Anfang klar, wohin die Reise geht: nach Schweden nämlich, und zwar im Zeichen des Folk Horrors (diverse Blogs nehmen Midsommar zum Anlass an Klassiker wie The Wicker Man (1973) zu erinnern). Eine Gruppe junger US-Amerikaner (u.a. Florence Pugh und Jack Reynor als Paar am Beziehungsende) kommt der Einladung ihres schwedischen Kommilitonen nach, in seiner Heimat den ganz besonderen Mittsommer-Festivitäten seiner Kommune beizuwohnen. Dass diese für die Besucher nicht besonders glücklich verlaufen werden, liegt auf der Hand.

Midsommar ist freilich komplexer und viel mehr als eine reine Horrormär von Amerikanern, die in die Fänge eines Kults geraten, dies wird bereits in der Exposition deutlich. Von Beginn an ist der Film mit einer ähnlichen Stimmung des Unbehagens infiziert, die schon in Hereditary zu spüren war. Einiges mehr erinnert an den Vorgänger: familiäre Todesfälle und eine vergiftete zwischenmenschliche Atmosphäre als Ausgangspunkt, gegen Mitte des Films zermatschte Schädel und von da an ungebremste Fahrt in Richtung eines cineastischen Fieberalptraums. Der sich entfaltende Erfahrungsraum wird von zahlreichen drogengeschwängerten Momenten des rituellen Exzesses befüllt, durch Tänze oder einen aberwitzigen Sexualakt, teilweise verstärkt durch eine computergenerierte psychotropische Bildästhetik. Während dies für einen wabernden Flow sorgt, erzeugen die mit analogen Spezialeffekten umgesetzten Angriffe auf Körper für unbarmherzige Momente des Aufpralls. Sie schocken nicht nur zum Zeitpunkt ihres Ereignisses innerhalb der Handlung, sondern drängen wiederholt als affektives Bildgedächtnis auf die Leinwand zurück.
Zwar lässt sich das Geschehen rückblickend als traditionell verlaufende Horrorstory rekonstruieren, die Inszenierung des Plots verlagert stereotype Genrewendungen jedoch weitgehend ins Off. Eben weil diese ob ihrer genremäßigen Erwartbarkeit nicht mehr auserzählt werden müssen, wirkt Asters Inszenierung im Moment des Erlebens umso mehr einem Kontingenzraum geöffnet, in dem alles möglich erscheint und doch nichts willkürlich. Wie deutlich Aster den Handlungsverlauf bisweilen ganz offen vor den Augen der Zuschauer ausbreitet, ohne dabei irgendetwas preiszugeben, auf das es tatsächlich ankommt, zeigt sich unter anderem an den öfter zu sehenden Detailaufnahmen von Paganzeichnungen, die Handlungsfragmente detailliert vorwegnehmen, der Spannung aber keinerlei Abbruch tun. Diese generiert sich nicht allein über das was, sondern wie es geschieht. Der beschreibbare Handlungsrahmen wird zunehmend zum Gerüst der Ausgestaltung von Intensitäten.
Smart Horror

Der Filmwissenschaftler Jeffrey Sconce hat Anfang des Jahrtausends in einem einflussreichen Aufsatz den Begriff des Smart Cinema geprägt, der sich auf eine Reihe von Filmen bezieht, die zwischen Arthouse und Mainstream schwanken. Produziert von Tochterfirmen großer Hollywoodstudios verfügen sie über ähnliche Ressourcen und Auswertungsmechanismen wie größere Hollywoodproduktionen, doch wird hier viel freier Skurriles und Abgründiges integriert. Sconce verwendet den Begriff für ein breites Spektrum von Filmen, die mitunter recht unterschiedlich sind (Filme etwa von Todd Solondz, Wes Anderson oder Alexander Payne), einen gemeinsamen Kern erkennt er jedoch in thematischen Motiven wie emotionaler Dysfunktion und Kommunikationsunfähigkeit innerhalb weißer Mittelschichtsfamilien, plötzlich hereinbrechender Schicksalsschlägen und einer selbstreferenziellen, oft symmetrischen Bildgestaltung. Bevölkert von abgestumpften, narzisstischen oder sozial isolierten Figuren, oszilliert das Smart Cinema zwischen Drama und Komödie. Sconce sieht in ihm weniger ein Genre als vielmehr einen Grundton des Erzählens.
Das Grauen des Gemeinschaftssinns
Wie schon Hereditary lässt sich auch Midsommar als Horrorvariante des Smart Cinema begreifen, zuallererst in den zwischenmenschlich dysfunktional gekennzeichneten US-Amerikanern und der überästhetisierten Bildgestaltung, die in diversen Reviews mit Ikea-Werbung assoziiert wird. Die schwedische Sekte entwirft Aster hingegen als Gegenbild, das sich allerdings mindestens ebenso erschütternd darstellt. Die hyperfunktionale und erschreckend idyllische Verbundenheit der Sektenmitglieder inmitten der sonnendurchfluteten Naturkulisse ist sogar eine der wesentlichen Quelle des Horrors. Auch bei überwiegend gleißendem Tageslicht lässt sich ein düsterer Film gestalten. Besonders schockierend offenbart sich die unheimliche Seite des Gemeinschaftssinns, wenn die Sektenmitglieder an den Empfindungen anderer mit kollektivem Stöhnen, Weinen oder Frohjauchzen partizipieren.

Allerdings können solche Momente auch immer wieder ins Absurde und Lachhafte umschlagen. Dies ist denn auch insgesamt das eigentliche Grauen, das Midsommar verbreitet: Weniger das Spiel mit wohlig konsumierbaren Angstgefühlen als die Konfrontation mit Szenen, für die es kein adäquates Reaktionsmuster zu geben scheint. Am Ende schließlich kulminieren solche Kippmomente zu einem aberwitzigen Finale und versetzen einen endgültig in einen Mix aus immersivem Schock und hilflosem, distanziertem Lachen. Dass eine solche überwältigende Erfahrung nicht leicht zu verdauen ist und ähnlich wie Hereditary zu spalten vermag, liegt durchaus in der Strategie des Smart Cinema. Dies ist nicht auf den Erfolg in der breiten Masse angewiesen, sondern zielt umso intensiver auf ein Publikum, dass sich auch durch etwas radikalere Verunsicherungen lustvoll unterhalten lässt.
Den Film kann man in der ZDF-Mediathek streamen.
Neue Kritiken

Primate

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail
Trailer zu „Midsommar“
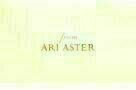
Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (8 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.
















