Make Way for Tomorrow – Kritik
Into the future we’ll travel alone: Wegen seiner egoistischen Kinder hat ein altes Ehepaar keine gemeinsame Zukunft mehr. Leo McCareys Make Way for Tomorrow (1937) hat den Ruf eines der traurigsten Filme aller Zeiten – dabei setzt er mehr auf Beobachtung als auf Überwältigung. Eine Wunschkritik unserer Abonennten.

Wenn die Jugend das Alter ermahnt, sich keine Illusionen zu machen: „Face the facts!“, muss sich Lucy (Beulah Bondi) von ihrer backfischhaften Enkelin Rhoda (Barbara Read) sagen lassen, ihr Mann werde in seinem Alter ja wohl keinen Job mehr kriegen. Für eine Siebzigjährige, antwortet Lucy, sei das mit den Fakten nicht so leicht wie für eine Siebzehnjährige: „The only fun you have left is pretending that there ain’t any facts to face, so would you mind if I just went on pretending?” In Rhodas Gesicht wandelt sich die jugendliche Ausgebufftheit, die sich ihrer Grausamkeit kaum bewusst war, in Betretenheit. Es gibt zahlreiche solcher Momente in Leo McCareys Make Way for Tomorrow (1937). Lucy aber hat die Haltung in Worte gefasst, mit der sie durch den Film geht und die ihm den Ruf eingetragen haben mag, einer der traurigsten aller Zeiten zu sein: weil Selbsttäuschung als Willensakt schon keine mehr ist, wir also jederzeit wissen, wie bewusst Lucy und ihr Ehemann Bark (Victor Moore) sich ihrer aussichtlosen Lage sind, auch und gerade dann, wenn sie noch einmal richtig glücklich scheinen.
Fünf letzte gemeinsame Stunden

Auf den Erinnerungsspuren ihrer Flitterwochen vor 50 Jahren machen die beiden im letzten Drittel des Films eine kleine Tour durch New York. Dass die Hauptdarsteller beim Dreh deutlich jünger waren als ihre Figuren – Victor Moore war 61, Beulah Bondi sogar erst 48 –, darauf würde man nicht kommen, und trotzdem bringen sie in den einander zärtlich zugewandten alten Leuten auch das frischverliebte Paar von früher zum Vorschein. Sie spazieren Arm und Arm durch den Central Park, lassen sich in einem Luxusauto durch Manhattan fahren, innig vertraut in ihren kleinen Kabbeleien; der sie chauffierende Verkäufer, der sie vorm Schaufenster seines Ladens aufgegabelt hat, sieht dem alten Paar die Mittellosigkeit vielleicht nicht an und tatsächlich potenzielle Kundschaft in ihm – mag aber auch von der Freundlichkeit angesteckt sein, die jenseits der Familiengefilde in den Film Einzug hält. Lucy und Bark kehren in ihr Hotel von damals ein, bekommen einen Old-Fashioned-Cocktail spendiert, und als sie sich auf die Tanzfläche wagen, spielt der Kapellmeister extra für die alten Leute einen langsamen Walzer, was die Paare ringsum nach kurzer Irritation gerne hinnehmen.

Die „facts“ der Depressionsära werden hinter dieser aufleuchtenden besseren Zeit nicht unsichtbar. So huscht Bark beim Spaziergang kurz in einen Laden und gleich wieder hinaus, am unübersehbaren „Mitarbeiter gesucht“-Aushang vorbei. So schneidet McCarey gegenüber dem Traumhotel auf eine Bankfiliale, jene Institution, die das Haus der beiden gepfändet hat, aus dem sie am Anfang des Films ausziehen mussten. Verloren ging dabei auch das Buch mit dem Hochzeitsgedicht, das allein man ihnen nicht nehmen kann und das Lucy nun zitiert: „Into the future we’ll travel alone. With you, said the maid, I’m not afraid“, lauten die letzten Verse. Und auch wenn einem noch so sehr danach ist, würde es sich fast wie ein Verrat anfühlen, jetzt loszuheulen, statt die feierlich-gefasste Stimmung zu teilen, in der die beiden die letzten fünf Stunden vor ihrer vermutlich endgültigen Trennung zu einer Ewigkeit machen. Oder, weniger schwelgerisch ausgedrückt: statt mit ihnen den Augenblick zu genießen. Denn schwelgerische Formulierungen passen nicht so recht für einen Film, der kaum auf affektive Überwältigung setzt, im Tonfall beinah nüchtern bleibt und im Urteil zurückhaltend, sparsam auch im (wenn, dann meist innerdiegetischen) Musikeinsatz.
Studien über Verlegenheit

Make Way for Tomorrow, trotz Fans wie Orson Welles und Peter Bogdanovich und trotz seiner Inspiration für Ozus Tokyo Story (1953) ein bis heute recht unbekannter Film, fiel seinerzeit beim Publikum völlig durch. Vielleicht, weil er sich nicht nur einem Happy End verweigert, sondern dafür noch nicht einmal einen befreiend leicht zu verdammenden Antagonisten im Gegenangebot hat. Dabei scheint der Fall vordergründig klar: Weil keines ihrer fünf Kinder willens ist, beide Eltern bei sich aufzunehmen, müssen diese am Ende auseinandergehen; Bark zieht nach Kalifornien zur (als einziges Kind im Off bleibenden) Tochter Addie, Lucy hat sich ohne sein Wissen schon im Altersheim eingerichtet. In der ersten Stunde indessen sehen wir, wie Lucy vorübergehend bei Sohn George (Thomas Mitchell) und Bark bei Tochter Cora (Elisabeth Risdon) aufgenommen werden, und auch wenn die – fraglos nicht sonderlich sympathischen – Kinder hier wie dort schon bald versuchen werden, die störenden Eltern wieder loszuwerden, nutzt das der Film dramaturgisch kaum aus, um Abneigung gegen sie zu erzeugen.

Stattdessen lässt seine unparteiliche Inszenierung zwischen Blick- und Wortwechseln langerprobte familiäre Rollenverteilungen sichtbar werden und erschafft dabei immer wieder ein Gespür für Situationen, die für alle Anwesenden im Raum gleichermaßen unangenehm und überfordernd sind. Und wo ein mit mehr Wucht ins Werk gehendes Melodram auf große Emotionen setzen würde, da widmet sich McCarey in seinen Familien-Beobachtungen ausführlich dem eher unspektakulären Gefühl der Verlegenheit. Das kann sich bündeln im Knarzen eines Schaukelstuhls, auf dem Lucy wie bestellt und nicht abgeholt am Rande der Bridge-Gesellschaft sitzt, mit der sich ihre Schwiegertochter im Wohnzimmer etwas dazuverdient, um die ohnehin schon zu kleine Wohnung in den schweren Zeiten halten zu können. Denn, auch das ist klar und macht die Sache noch einmal vertrackter, die Folgen der Großen Depression machen sich auch im Leben der Kinder bemerkbar.
Ausgewogene Sympathieverteilung

Zwischen Lucy und Anita (Fay Bainter) baut McCary die stärksten Spannungen auf, kulminierend in einer Streitszene, die gegen die Gepflogenheiten des continuity systems in Achsensprüngen montiert ist und mit nur knapp an der Kamera vorbeizielenden Blicken beider Figuren auch an der vierten Wand kratzt (eine sehr ausführliche Analyse findet man hier). Der formalen Gleichberechtigung entspricht eine ausgewogene Sympathieverteilung. Man kann Anitas Ärger über Lucys Einmischung in die Erziehung ihrer Tochter durchaus nachvollziehen, selbst wenn man mit der liberaleren Einstellung der Großmutter mehr sympathisiert – ihrer Entscheidung etwa, Rhoda nicht zu verpetzen, als die bei einem gemeinsamen Kinobesuch zu einem Date ausbüxt. (Die Szene, eines der vielen Kleinode des Films, gewährt einen Einblick in die Kinokultur anno 1937 und in die Leichtigkeit, ein prototypisches Drama notfalls auch ungesichtet nachzuerzählen.)

Leichter fällt die Parteinahme für Bark, dessen resolute Tochter Cora ihn, um beim Hausbesuch des Arztes den Schein zu wahren, von der Wohnzimmercouch schnell ins Schlafzimmer verfrachtet und den jüdischen Verkäufer Max Rubens (Maurice Moscovitch) von der Tür weisen will, mit dem Bark sich angefreundet hat – dessen Laden wird Barks Zufluchtsort und eine der freundlichen kleinen Gegenwelten des Films. Allerdings sorgen der Starrsinn des Großvaters und seine gelegentlich galligen Sarkasmen nicht nur für den komödiantischen Anteil des Films – etwa wenn er die geleckte Freundlichkeit des jungen Arztes auflaufen lässt –, sondern lassen ein ebenso langgenährtes Konfliktpotenzial vermuten wie Lucys oft enervierend begütigende Übersicht über alles.
Alles müsste anders sein

„We’re probably the most good-for-nothing bunch of kids that were ever raised, but it didn’t bother us much until we found out that Pop knew it too“, meint der hallodrihafte Sohn Robert (Ray Mayer), als den im Apartment von Nellie (Minna Gombell) versammelten Geschwistern klar wird, dass sie nicht mehr pünktlich am Bahnhof sein werden, um ihren Vater zu verabschieden. Dass die Unfähigkeit zur Selbsttäuschung auch sie eint, wird besonders in der für mich am schwersten erträglichen Szene deutlich, in der Lucy den Brief vom Altersheim findet, das Sohn George hinter ihrem Rücken kontaktiert hat. Noch bevor er etwas dazu sagen kann, tut sie so, als wäre das Ganze ihre Idee gewesen, und gesteht ihm dann auch noch, dass er immer ihr Lieblingskind gewesen sei. Wenn daraufhin George, zugleich entlastet, gelobt und gedemütigt, seiner Frau in der nächsten Szene sagen wird, dass sie heute stolz auf ihn sein könne, in einem Ton und mit einer Miene, die das glatte Gegenteil verraten, ist klar: Hier macht sich niemand über sich selbst etwas vor.

Make Way For Tomorrow ist gerade deshalb so aufreibend traurig, weil das, was Lucy und Bark widerfährt, kein unabwendbarer Schicksalsschlag ist. Hinter jeder Weichenstellung, die zu ihrer Trennung führt, steht die Entscheidung einer Figur, die sich, so meint man, auch anders hätten entscheiden können. Zugleich macht es der Film kaum möglich, über diese Figuren ohne die ehrliche Frage „Wie hätte ich gehandelt?“ zu urteilen. Auch als Zuschauer im Jahr 2019 können einem diese Familienprobleme unter den Jeder-ist-sich-selbst-der-Nächste-Bedingungen des Kapitalismus noch vertraut erscheinen. Der Film entlässt keine seine Figuren aus ihrer Verantwortung und macht die Verhältnisse, in denen sie stecken, doch unübersehbar. Der konservative Katholik McCarey hat damit sicher keine Systemkritik üben wollen. Und doch lässt dieser nicht zornige, aber zutiefst melancholische Film keinen Zweifel daran, dass alles anders sein müsste.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Make Way for Tomorrow“

Trailer ansehen (1)
Bilder

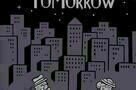


zur Galerie (16 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Short Cut
Liebes Critic.de Team,
vielen, lieben Dank für diese außergewöhnliche, wunderbar geschriebene Kritik zu einem der vielleicht schönsten Filmen der 30er Jahre !
Vielen Dank !













1 Kommentar