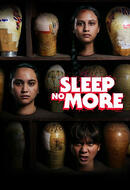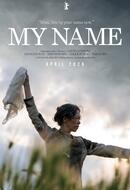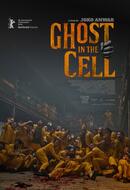Little Joe - Glück ist ein Geschäft – Kritik
Am Beispiel der Pflanze. In ihrem ersten englischsprachigen Film erschüttert Jessica Hausner die Autorität der Gefühle. Little Joe hat nur einen Fixpunkt, aber in ihm sammelt sich die ganze Welt.

Ein großes Nichts namens Little Joe steht im Zentrum von Jessica Hausners gleichnamigen Film, und es tritt auf in Gestalt einer neuen Pflanzenart. Immer wieder nimmt die Kamera, entweder von oben oder seitlich, das Treibhaus in den Blick, die grünen Stängel mit ihren knallroten Blüten und ihrem skurrilen Glücksversprechen. Der botanische Clou des Films wird gleich am Anfang ohne viel Aufhebens über ein Gespräch zwischen Labormitarbeitern geklärt: Little Joe ist zwar sterilisiert, kann sich nicht mehr fortpflanzen, sein intensiver Duft soll aber, solange man die Pflanze warmhält und mit ihr spricht, positive Vibes verströmen, man erhofft sich auf der anstehenden botanischen Messe einen entsprechenden Triumph für das pflanzliche Antidepressivum.
Die Verunsicherung im Blick

Das Team um Pflanzenzüchterin Alice (Emily Beecham) hat dafür jenes Hormon isoliert, das nach der Geburt die Mutter-Säuglings-Bindung festigt; ein nicht unwichtiges Detail, denn die Mutter-Kind-Bindung ist gerade auch Thema in Alices Privatleben. Little Joe ist nach Joe (Kit Connor) benannt, ihrem Sohn, der gerade in die Pubertät kommt, gern etwas mehr von seiner vielbeschäftigten Mutter hätte, aber trotz allem nicht zu seinem Vater ziehen will. Alice schenkt Joe eine Pflanze, und Joe verändert sich. Und Little Joe ist über seine gesamte Laufzeit mit der Frage befasst, ob zwischen diesen beiden Sätzen ein kausaler Zusammenhang besteht. Denn die verrückte Bella (Kerry Fox), dienstältestes Mitglied im Laborteam, ist sich, nachdem ihr Hund Bello durchdreht, sicher, dass Little Joe gefährlich ist. Ihre These: Die Pflanze reagiert auf ihre eigene Sterilität und injiziert mit ihren Pollen einen Virus im Menschen, um ihre Reproduktion auf anderem Wege sicherzustellen.

Von nun an kippt der Film nicht, aber wird zum Kippbild. Die Einstellungen scheinen weiterhin fest verankert, aber im Bild selbst gerät allmählich alles in eine ungute Schwebe. Alice ist sich zunächst sicher, dass an Bellas These nun wirklich gar nichts dran ist; umso mehr ist sie später von ihrer Wahrheit überzeugt. Die Menschen um sie herum verhalten sich immer merkwürdiger. Little Joe hat großen Spaß am Verhältnis von unnatürlichem Verhalten und nicht-naturalistischem Schauspiel: Wessen Körper sind hier gefressen worden (oder eben nicht)? Und auch die Kamera scheint verunsichert, scannt mit ihren langsam seitlichen Bewegungen, die sich um Figuren wenig scheren, das Bild nach Indizien ab. Sie scheint weniger einem Bewusstsein zu gehorchen als eine Überwachungscam zu sein, die nicht versteht, was sie da überwacht. Die Verunsicherung steckt nicht im Material, sondern im Blick selbst.
Pubertät oder Virus?

Dabei geht Little Joe über den Psychofilm hinaus, der sein Publikum autoritär zur Unsicherheit verdammt. Der zunächst strenge Duft nach Genre ist ein künstlicher. Klar ist Little Joe ein Invasion of the Body Snatchers ohne Aliens, sozusagen rein pflanzlich. Und wie die besten Horror- und Science-Fiction-Filmen fragt er nicht nach dem Menschlichen im Monster, sondern nach dem Monströsen im Menschen. Schon wird der Film in Cannes als Kritik an Antidepressiva missverstanden, aber entscheidend ist nicht die Manipulation, sondern die Beschaffenheit des Manipulierten. Es geht um Veränderungen, und wie man mit ihnen zu Rande kommt, um Gefühle und Wünsche, die sich immer nur vermittelt äußern, sich an Objekte haften, und schon steht ihre Beschaffenheit in Frage. Sohn Joe hat auf einmal eine Freundin, der Kollege will mit ihr ausgehen. Niemand bleibt sich treu, wie unheimlich.
Prisma der Gegenwart

Mutation, Manipulation, natürliche und unnatürliche Veränderungen. Was Hausner in Little Joe konstruiert, ganz ähnlich wie schon in Lourdes, ist eine Zone der Unentscheidbarkeit. Wie Alice auf das Verhalten ihrer Mitmenschen können wir uns auf sein ästhetisches Programm irgendwann keinen Reim mehr machen. Was will der Film, was treibt ihn zum Handeln? Geht es hier, man beachte die phallische Form der Pflanze, nicht eigentlich um Männlichkeit, die sich nicht nur biologisch, sondern gesellschaftlich fortpflanzt? Geht es hier nicht, von wegen (un)organisches Wachstum, eigentlich um den Kapitalismus, weil die sterilisierte Pflanze zur Ware werden muss, um zu überleben; von der biologischen in die ökonomische Ordnung wechselt? Geht es hier, schon wie das Teil am Ende das Foyer von Alices Therapeutin schmückt, nicht um die schönen Yoga-Beruhigungen unserer in Depressionen versinkenden Bio-Gesellschaft? Gerade auch weil sie affektiv selbst kaum aufgeladen wird, ihre Faszination sich über das Bild nicht vermittelt, wird Little Joe zum Prisma der Gegenwart.

Dass diese Dinge und noch viel mehr in Little Joe stecken (können), hat nicht damit zu tun, dass Hausner ihre Konstruktion ornamental ausgeschmückt und in alle Richtungen erweitert hat. Sie hat sie im Gegenteil so durchlässig wie möglich belassen, um das Soziale hineinströmen zu lassen. Ihre wie immer neurotisch kontrollierten Bilder sind der perfekte Rahmen, um in Abgründe zu starren, die Pflanze ist nur das Medium. Es gibt keinen Moment in diesem Film, der nicht auf sie bezogen wäre, und zugleich ist sie nur eine Leerstelle, die Verhältnisse ins Wanken bringt: zwischen Gefühl und Selbst, zwischen Figuren, zwischen Film und Zuschauer.
Neue Kritiken

Der große Wagen

Ella McCay

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice
Trailer zu „Little Joe - Glück ist ein Geschäft“


Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (14 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.