Die Wütenden - Les Misérables – Kritik
2005 drehte Ladj Ly eine Webdoku über die Banlieue-Aufstände. Sein Spielfilmdebüt Les Miserables feiert erst in Paris den jüngsten WM-Titel Frankreichs, um dann ein weiteres Feuer in den Vorstädten zu entfachen.

Das Schlussbild bleibt offen, verabschiedet sich in die Schwarzblende. Aber nicht, weil hier eine Ambivalenz konstruiert würde, ein Sowohl-als-auch, ein Einerseits-Andererseits. Eher weil die Zukunft eben furchterregend offen ist. Das Schlussbild ist der Gipfel einer Actionsequenz, ein Aufstand im Pariser Vorort Montfermeil, in dem drei Cops in eine Falle laufen. Dass auch der Anfang des Spielfilmdebüts von Ladj Ly vom Ausnahmezustand bestimmt war, hat man da schon fast vergessen. Dort war Frankreich Fußballweltmeister, alles strömte auf die Straßen von Paris, die französische Jugend, teils in Flaggen gehüllt, hüpfend, springend, singend. Schon hier spürte man, warum Ly vor allem durch Web-Dokumentationen bekannt ist. Dann aber überformte er die Wuselbilder mit einem Tableau der frenetischen Massen vor dem Arc de Triomphe, über den er dann mit Lust an der großen Geste in riesigen Lettern den ohnehin schon großen Titel seines Films legte: Les Miserables.
Vom Rand ins Zentrum, vom Zentrum an die Ränder

Durch die Gegenüberstellung von Anfang und Ende, von Freudentaumel und Gewaltaufstand, von Feuerwerk und Pulverfass wird der Fußball nicht zum Opium eines Volkes, das vor den eigentlichen Problemen die Augen verschließt. Die Kids, die wir da beim Feiern begleiten, sind schließlich in Montfermeil in die Bahn gestiegen, um nach Paris zu fahren. Einem von ihnen wird das Schlussbild gehören.
Es geht hier nicht um zwei sich gegenüberstehende Seiten der Gesellschaft, sondern um zwei Bewegungen, die sie durchziehen: eine von der Peripherie ins Zentrum, bei der die Nation noch einmal als Integrationsmaschine wirkt, und eine vom Zentrum in die Periphere, mittels derer der Staat diejenigen zu kontrollieren trachtet, die nichts kontrollieren als das eigene Überleben.
Mit dieser zweiten Bewegung setzt der Plot ein. Polizist Stéphane (Damien Bonnard) hat sich nach Montfermeil versetzen lassen, um seinem bei der Mutter lebenden Sohn näher zu sein, und jetzt ist er bei einer Anti-Crime-Sondereinheit gelandet, die in Zivil durchs Viertel streift, weniger als Freund und Helfer denn als Besatzungsmacht auftritt. Das Kommando hat Chris (Alexis Manenti); stets unter Strom, immer ein bisschen street wisdom parat, weniger cooler Dirty Harry als cholerischer Popeye Doyle aus The French Connection (1971).

Und dann gibt es noch Gwada (Djebril Zonga), seinen jungen Partner, der die Ruhe und damit Chris vor allzu krassen Eskapaden bewahrt, auch mal die Sprache wechseln kann, wo Französisch nicht mehr weiterhilft. Stéphane fährt mit und redet den ersten Teil des Films so gut wie gar nicht, muss Spott über sich ergehen lassen, versucht sich an ersten klaren Ansagen, die ins Leere laufen, spricht bei seinem ersten Auftritt in einem Café der Muslimbrüder so gestelzt höflich, dass die Anwesenden nur irritiert staunen.
Die Drohung der Drohne

Kurz: Stéphane ist so unbeholfen und ahnungslos, wie das bürgerliche Kino jenen Welten meist gegenübersteht, die es so gern besser verstehen würde, um irgendwas wiedergutzumachen. Und so ist es wohl konsequent, dass wir, obwohl der Regisseur selbst sein ganzes Leben in Montfermeil verbracht hat, diesen Film aus der Perspektive des Fremden erleben, mit seinen Augen sehen, irgendwo zwischen verängstigt und wachsam, ein bisschen mitstottern, während sich das Viertel an den Rande des Gangkrieges begibt, weil aus dem Zirkus der „Gypsies“ ein Löwenbaby verschwunden ist. Was Stéphane und wir bald lernen: Auch der Besatzungsmacht geht’s ums Überleben, auch die Cops müssen lokale Machthaber schmieren, Allianzen schmieden, kleine Deals eingehen. Sie sind Überwacher, aber auch Teil einer komplexen Ökonomie, die einen eigenen Mikrokosmos nur die nennen können, die glauben, mit ihr nichts zu tun zu haben.
Dabei weiß jede Drohne, dass man schnell Paris sieht, wenn man den Häuserschluchten der Banlieues entsteigt. Immer wieder ergeht sich Les Miserables in diesen Drohnenbildern, aber nicht aus Stylegründen. Wenn der kleine Buzz (Al-Hassan Ly) sein neues Spielzeug in die Lüfte schickt, dann geht es auch hier um Bewegungen und ihre Umkehrung, um die Aneignung des staatlichen Überblicks mitten aus dem überblickten Gewusel heraus. Und als Buzz mit dieser Drohne schließlich filmt, wie Gwada im Affekt seine Flashball-Waffe ins Gesicht eines Teenagers feuert, da wird die Drohne zum dramaturgischen Motor: Die Cops müssen der Videobilder unbedingt habhaft werden, und so beginnt eine Jagd, an deren Ende das Gerät wütend an die Wand geschmettert wird, weil die Speicherkarte längst weg ist. Die Drohne ist Blickprinzip des Films, MacGuffin, Symbol für Macht und Widerstand, schließlich konkreter Affekt, in ihr finden Ästhetik, Plot und Politik des Films zueinander.
Iñárritu sprengen

Zwischendurch irritiert Les Miserables aber auch, vielleicht weil er weder einen knallharten Sozialrealismus vorbringt – sich durchaus in manchmal abstrus konstruierte Plotbahnen wirft – noch einen Ausweg in einem rein filmischen, nur vermittelt interpretierbaren Universum sucht. Dokumentarische Basis und fiktionaler Überbau kommen sich manchmal mehr in die Quere, als einander zu verstärken, und manchmal ist es, als würde Ly beim Nachzeichnen der Gesetze der Straße durch die Hintertür wieder jenen Schematismus einführen, den er mit seinem Interesse an konkreten Bewegungen und Verkettungen auf Bildebene eigentlich ständig verdrängt.
Schließlich wähnt man sich gegen Ende fast bei Iñárritu, als eine Sequenz gegeneinander schneidet, wie die drei Cops nach Hause kommen – Gwada zu seiner Mutter, Chris zu seiner Familie, Stéphane in die noch leere Wohnung – und die sonst drängende Musik auf einmal nachdenklich wird: Da scheint Les Miserables per Parallelmontage das babylonische Sprachgewirr mit grobschlächtiger Filmsprache einfach zu übertönen, die disparaten Erfahrungen in einer einzigen menschlichen auflösen zu wollen.

Doch es ist diese Sequenz, die Les Miserables mit seinem Schluss wieder wegsprengt, die Gleichschaltung des Episodenfilms wird nur zitiert, damit die Wut ihren Platz als affektiver Motor nochmals umso bestimmter einnehmen kann. Dann wird Issa, das Opfer des Schusses mit seinem entstellten, aufgedunsenen Gesicht, zum Racheengel, der eine ganze Armee vermummter Kids anführt. Les Miserables betrauert hier nicht mehr den Ausschluss, beschwört nicht mehr die Menschlichkeit der Abgehängten, sondern weiß, dass die letzte Möglichkeit der Marginalisierten meist die ist, zu jener anonymen Masse zu werden, die man aus Sicht des Zentrums ohnehin bereits ist. Und dann ist alles offen.
Neue Kritiken

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Die Spalte
Trailer zu „Die Wütenden - Les Misérables“


Trailer ansehen (2)
Bilder

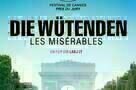


zur Galerie (12 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.















