Isadoras Kinder – Kritik
Neu auf VoD: Die Tänzerin Isadora Duncan schrieb die Choreografie Mother nach dem Tod ihrer Kinder. Vier Frauen wollen das Stück in ihre Lebenswelt übersetzen. Isadoras Kinder ist ein Gespensterfilm über den Verlust als Band, das Zeiten und Menschen verbindet.

Langsam, ehrfürchtig fährt die Hand über eine Seite im aufgeschlagenen Buch, streift kaum das Papier. „Mother“ ist die Seite betitelt. Nicht Buchstaben zieren sie, sondern geometrische Formen; aneinandergereihte Rechtecke, die sich über die gesamte Länge ziehen und an denen Dreiecke, Vierecke, Fünfecke docken. Es gibt weiße Flächen, schraffierte, schwarze; Punkte, Striche, Kreuze, Pfeile. Was aussieht wie die Bauanleitung für ein Holzmodell, ist tatsächlich eine Bewegungsanweisung: Wer der Labanotation mächtig ist, dem streckt sich hier jene Solo-Darbietung entgegen, die die US-amerikanische Tänzerin Isadora Duncan (1877–1927) choreografierte und schlicht Mother nannte.
Die Übersetzerin

Was wir in dieser kurzen Szene sehen, ist charakteristisch für die Haltung des vierten Spielfilms von Regisseur Damien Manivel. Im Mittelpunkt von Isadoras Kinder (Les enfants d’Isadora) steht Duncans Tanz, aber nicht als vollendete Performance, sondern als die Übersetzungsleistung, die der Vollendung vorausgeht: als etwas, was man sich erst aneignen muss, indem man es von einer Sprache in die andere, von einer Lebenswelt in die andere, von einer Zeit in die andere befördert. Im ersten Drittel des Films versucht sich eine junge Frau (Agathe Bonitzer) in Paris, deren Namen und Hintergrund wir nicht erfahren werden, an der Choreografie. Isadoras Kinder ist ganz auf diesen Versuch, auf den Prozess der Aneignung eines fremden Werkes gerichtet; nicht als Etappe auf dem Weg zu seiner vollendeten Reproduktion, sondern als der interessantere Moment, derjenige nämlich, in dem die Künstlerin und ihr Erbe sich die Hand reichen, Menschengeschaffenes vermittelt wird und überdauern kann.
Der Film zeigt nicht nur, wie die junge Frau der kryptischen Schrift Gesten entlockt und den zu seiner Aufbewahrung erstarrten Bewegungsablauf neu entfaltet – immer wieder sehen wir sie mit den Kopien aus dem Buch –, sondern auch, wie sie in Duncans Welt einzutauchen versucht. Mother entstand, nachdem Duncans Kinder 1913 bei einem Unfall gestorben waren. „Ich tanzte den Abstieg in das Grab und schließlich den Geist, der aus dem Fleisch, in dem er gefangen ist, flüchtet und emporsteigt, zum Licht emporsteigt“, schreibt Duncan in ihrer Autobiografie My Life. Immer wieder liest die junge Frau aus diesem Werk, im Bett, im Café, im Bus; die Worte legen sich im Voice-over über ihre Lebenswirklichkeit. Duncans zärtlicher Ton schwappt über in die Welt der jungen Frau, sublimiert die Körper um sie herum, verwischt die Grenzen zwischen dem Bewegen und dem Tanzen: Kinder tollen auf dem Schulhof, alte Menschen machen Gymnastik im Park, ein Mann massiert langsam seine Kopfhaut. Noé Bachs Kamera widmet ihnen dieselbe Aufmerksamkeit wie den Tanzbewegungen der jungen Frau, umrahmt sie mit denselben starren Einstellungen; ihnen allein soll die Bewegung gehören.
Das Volumen der Leerstelle

Dann wird die junge Tänzerin von zwei anderen abgelöst: In der Bretagne bereitet die Choreografin Marika Rizzi ihre Schülerin Manon Carpentier auf eine Aufführung von Mother vor. In einer der eindrücklichsten Szenen des Films weist Marika Manon an, so zu tun, als ob sie die beiden Kinder noch auf dem Arm halten würde, als wären sie ihr nicht eben unweigerlich entglitten. Die Choreografin ist nicht zufrieden, sie kann an Manons Bewegungen nicht die Leerstelle erkennen, in der Platz ist für die beiden imaginären Kinder. „Ich möchte, dass du dir das Volumen vorstellst, mit dem wir vorhin gearbeitet haben“, sagt Marika. Die Abwesenheit zeigen, ihr Raum geben: Was Manon an einer einzelnen Geste präzise herausarbeitet, steht stellvertretend für den Film. Er ist durchzogen vom Gefühl des Verlusts, von einer Lücke, die gerissen wird und klafft. Isadoras Kinder ist ein Gespensterfilm, er beschwört viele herauf, jedes wiegt sein eigenes totes Kind, aber das Gefühl ist dasselbe, die Bewegung ist dieselbe: das Klammern an etwas, das eben noch war.
Als Manon Mother vor Publikum aufführt, wendet sich die Kamera ab. Denn die unendliche Reise der künstlerischen Geste geht weiter. Jetzt, wo Duncans Werk in Manon aufgegangen ist, ist der Film nicht mehr bei ihr, sondern bei denjenigen, denen Manons eigene Interpretation entgegengestreckt wird: Mit der ihr eigenen Langsamkeit weilt die Kamera während der Aufführung an einzelnen Zuschauergesichtern, lässt uns nur an den Blicken, den Regungen das Dargebotene uns vorstellen. Auf einem Gesicht fließen Tränen; diesem Gesicht (Elsa Wolliaston) folgt Isadoras Kinder im letzten Drittel des Films nach Hause. Es ist ein beschwerlicher, langsamer Weg, denn die Frau ist gehbehindert, aber Isadoras Kinder kennt keine Behinderung, der Film kennt nur die Bewegung, kennt nur Körper, die sich auf ihre Weise durch die sublimierten Bildkompositionen von Kameramann Bach bewegen. Und so findet der Film in der Unbekannten eine vierte Frau, die die Bewegung aus dem letzten Jahrhundert wiederaufnimmt und ihre eigene Trauer in das Wiegen der verschollenen Kinder legt. „Ich habe meinen Tanz nicht erfunden, es gab ihn lange vor mir. Er schlummerte jahrhundertlang, und meine Trauer hat ihn aufgeweckt“, schreibt Duncan in My Life.
Den Film kann man sich bei MUBI ansehen.
Neue Kritiken

Ungeduld des Herzens

Melania

Primate

Send Help
Trailer zu „Isadoras Kinder“

Trailer ansehen (1)
Bilder


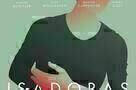

zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.











