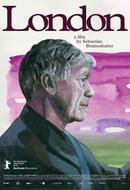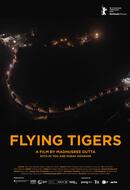Lamb – Kritik
Lamb erzählt in unterkühlter Langsamkeit von einem Hirtenpaar, das ein Schafskind mit menschlichem Körper großzieht – und flüstert Fragen über Anthropozentrismus und Transhumanismus in den isländischen Nebel.

Wo die filmische Welt von Valdimar Jóhanssons Spielfilmdebüt Lamb nicht von kaltem Nebel bewohnt oder von braungrünen Weiden überzogen ist, steht einsam der Hof von Maria und Ingvar. Das schweigsame, ernste Paar lebt mit Hunderten Islandschafen, einem Hund und einer Katze in einer namenlosen Tallandschaft. Dieses Eremitenleben scheint von Anfang an ein trauriges zu sein. Während es im ersten von drei Kapiteln in unterkühlter Langsamkeit erzählt wird, begleitet von den runden, schwarzen Augen der Schafe, kann uns dämmern, dass es in dieser Landschaft keine schnellen Antworten gibt. Wenn überhaupt, dann nur am Horizont.
Schafskind

Auf isländischen Höfen werden Anfang Mai die Lämmer geboren, bald danach beginnt der Auftrieb in die Berge. Maria (Noomi Rapace) und Ingvar (Hilmir Snær Guðnason) sind die Hebammen der Schafsmütter, helfen bei der Niederkunft, versorgen die Neugeborenen. Eine bestimmte Geburt aber bringt das Leben der beiden und auch den Film aus dem Gleichgewicht: Ein Lamm liegt in Marias Armen, das beide entsetzt und entzückt zugleich. Erst mit der Zeit, zunächst sorgsam mit Wolldecken abgeschirmt und in einer Stahlwanne behütet, offenbart sich die Besonderheit: Das Schafskind ist ein Mischwesen mit menschlichem Körper. Für das Paar scheint sich unerwartet das Glück des Elternwerdens zu erfüllen, in aller Stille beschließen sie, es als ihr eigenes großzuziehen.

Ideengeschichtlich ist das Lamm nicht zuletzt eine biblische Gestalt. Im Alten Testament Opfertier im Zentrum des Pessach-Festes, im Neuen als Agnus Dei das Symbol für Jesus Christus und seine Auferstehung. Dessen ist sich Lamb bewusst, schon das Filmplakat stilisiert Noomi Rapace in ölmalerischer Manier zur Mutter Gottes, ihre Figur heißt Maria, ihre Geburt ist eine unbefleckte. Darüber hinaus lässt der Film uns mit dringlichen religiösen Hinweisen in Ruhe. Überhaupt lässt er uns allein in der isländischen Landschaft und auf dem Hof, rückt nur langsam mit der Erzählung heraus.
Akt der Hybris

So beliebt der Begriff „Hybrid“ heute ist: In seiner modernen Bedeutung brachte ihn der mährisch-österreichische Augustinerabt Gregor Mendel auf, der durch seine Forschung zur Vererbungslehre Geschichte schrieb. Er bezeichnete damit ursprünglich etwas, das Gott nicht gewollt hatte, nämlich seine eigenhändig durchgeführten Kreuzungen von Pflanzen. Die selbstermächtigende Erzeugung dieser Mischwesen erschien ihm als Hybris, altgriechisch für Übermut oder Anmaßung. So glücklich die Adoption des wundersamen Chimären in Lamb das kinderlose Paar auch zu machen scheint – zugleich ist als nebelige Bedrohung immer präsent, dass auch sie ein Akt der Hybris ist.

Das wird spätestens offenbar, wenn Maria gegen die Schafsmutter zum Gewehr greift und ihren Körper wie Achilles den Hektor über die Weide schleift. Auch als der Bruder von Ingvar auf dem Hof eintrifft und sich auf dem Hof mehr und mehr zwischenmenschliche Szenen abspielen, wird uns deutlich gemacht, dass das Kind-Schaf Ada nicht das Menschen-Kind werden kann, zu dem es Maria und Ingvar machen wollen. Auch der Bruder Petúr verfällt der niedlichen Ada nach anfänglicher Abscheu, und vorübergehend zeichnet sich ein gewisses Idyll an der Oberfläche ab. Dieses wird schließlich im dritten Akt von einem schafsköpfigen Deus ex Machina jäh beendet. Ein muskulöses Mann-Schaf tritt hinter den Bergen hervor, und das Idyll endet in einer plötzlichen Hölle.
Zwischen Folk-Fantasy und Parabel

Anthropozentrismus ist hochmütig, Transhumanismus gefährlich und Glück nur vorübergehend: Mit solchen Thesen bewegt sich Jóhanssons Film inmitten aktueller Diskurse. Aber sie bleiben bis zuletzt unausgesprochen oder höchstens geflüstert. Ob man eine obskure Folk-Fantasy-Geschichte oder eine anmutige Parabel sieht, soll dabei nie ganz entschieden werden. Während es solche feingliedrigen Ambivalenzen sind, die begeistern können, hätte Lamb doch etwas mehr Entschiedenheit gut getan. Denn als Fantasyerzählung macht er eine fahle, enttäuschende Figur: Als solcher wird ihm seine eigene Stimm- und Bilderlosigkeit zum Verhängnis.

Weil das Ende dann noch einmal einen derartigen Bruch darstellt, ist es dieses, das am ehesten darüber entscheidet, wo der wundergleiche Apfel vom Stamm fällt. Warum braucht es den baphometartigen Rachegott, um dem Film zu einer Konklusion zu verhelfen? Und musste er sich selbst als neoklassische Literatur in drei Akten aufzäumen? Antworten muss man im isländischen Nebel suchen, in dem Lamb endet.
Neue Kritiken

Allegro Pastell

A Prayer for the Dying

Gelbe Briefe

"Wuthering Heights" - Sturmhöhe
Trailer zu „Lamb“
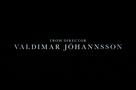
Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (12 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.