Das Haus am Meer – Kritik
VoD: Wie ein einst paradiesischer Küstenort der Abgeschiedenheit entrissen wird. Robert Guédiguian schaut in Das Haus am Meer auf drei Leben, auf sein Werk, auf die Welt.

„Was soll’s“, sagt der alte Maurice (Fred Ulysse) und zündet sich eine Zigarette an. Irgendetwas lässt ahnen, dass das schlecht ausgehen wird. Irgendetwas verbietet aber auch den Verdacht der Leichtsinnigkeit. Vielleicht ist es der bedeutungsschwere Blick auf das im Sonnenaufgang glitzernde Mittelmeer, vielleicht ist es Maurice’ wettergegerbtes Gesicht, das uns der Gegenschuss der Kamera offenbart, die hellblauen, wie ausgewaschenen, ausgelebten Augen. Die Szene verströmt Würde und Ernst; und wenn man inmitten einer solchen Schönheit stirbt, sei’s drum. Der Anfang und das Ende, die Resignation und die Entschlossenheit, vereint in dieser schönen Szene, in der ein Mann von einem Schlaganfall übermannt wird, während ein neuer Tag geboren wird.
Die Calanque als Theater

Auftritt Angèle (Ariane Ascaride), Joseph (Jean-Pierre Darroussin) und Armand (Gérard Meylan), Maurice’ Kinder. Das Haus am Meer (Life Is a House) spielt in einem Dorf an der Küste unweit von Marseille. Wie ein Leitmotiv, wie eine starre und unwirklich schöne Theaterkulisse zieht sich durch den Film die streng komponierte Aufnahme des Ortes vom Meer aus: im Vordergrund der ordentliche Hafen und die bunten, mehrheitlich leer stehenden Häuser, geschart um die Bögen eines Viadukts, der den Blick in die Höhe zieht. Immer wieder braust darüber ein Regionalzug, verweist in ein Anderswo, das nie gezeigt wird, aber alle Gespräche dominiert. Die Brücke erinnert an ein antikes Theater, ebenso die Terrasse des titelgebenden Hauses, auf der sie alle deklamieren, ihre Rolle einnehmen und neu verhandeln. Denn das Familiengefüge ist mit dem Schlaganfall verrückt. Der vegetierende Körper des Familienältesten – die Angehörigen sind sich uneins, ob er noch etwas wahrnimmt –, das in einem Schreckensausdruck erstarrte Gesicht bleiben bis zum Schluss regungslos, lösen aber allerlei Regungen aus.
Die Unmöglichkeit der Insularität

Denn Angèle, Joseph und Armand bringen ihr Päckchen Elend ans Bett des kranken Vaters, ein Drama jeweils, das eng an den Ort geknüpft ist. Dabei geben die individuellen Dramen in unterschiedlichem Maße ein Echo auf gesellschaftliche Veränderungen ab. Ihr deutlichstes Sprachrohr ist Armand. Er hat das väterliche Restaurant übernommen, weiß aber nicht, wie dieses seiner Tradition – „gut und billig“, sagt er einmal – treu bleiben soll. Denn die besten Absichten prallen auf eine Welt, deren Wandel Das Haus am Meer treffsicher einfängt. Guédiguians Dekor, die Handvoll Schauspieler erwecken den Anschein von Insularität, doch das trügt. Wie einst vielleicht das Wasser durch die geschwungenen Zwischenräume des Viadukts floss, ergießen sich über das einstige Paradies, wie der alte Nachbar Martin (Jacques Boudet) den Ort bezeichnet, radikale Veränderungen. Guédiguian deutet sie im Register des Unbehagens an. Unbehagen, als Angèle stutzig um sich schaut und fragt, warum der Ort ihrer Kindheit wie leergefegt sei. Unbehagen, als Joseph die Straße hochläuft und die Abscheulichkeit neuer Baumaterialien beklagt. Unbehagen, als ein elegantes Boot in den Hafen einfährt und der Verdacht einer Begutachtung durch Investoren aufkommt. Unbehagen, als Militärfahrzeuge erscheinen. Es sind kleine Einbrüche, geradezu Angriffe auf die Abgeschiedenheit des Ortes, die seine Fragilität offenbaren.
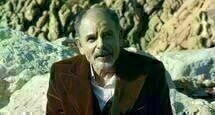
Doch Guédiguian zelebriert nicht die einstige Insel, verliert sich nicht in der Nostalgie, trotz eines wunderschönen Zitates aus seinem Film Ki lo sa? (1987), das die Darsteller vor dreißig Jahren zeigt, in derselben Konstellation, am selben Ort. Für Angèle, Joseph und Armand kommt die Läuterung vom Meer; das Meer, das in diesem Film die Rolle der Grenze zwischen den Menschen spielt, die auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten ist. Denn in die Beschäftigung der Geschwister mit der eigenen Vergangenheit spült das Mittelmeer spiegelartig drei andere Geschwister, ebenfalls ein Mädchen und zwei Jungen. Als Armand und Joseph im Wald Wege anlegen, lesen sie sie zufällig auf: erschrocken, stumm, erschöpft und dreckig, aber ohne jeden Zweifel der Inbegriff der Menschlichkeit, einer ursprünglichen, in ihrer Natürlichkeit fast tierischen Menschlichkeit; die Menschlichkeit einer großen Schwester, die die kleineren Brüder wie Vögel in einem Nest füttert; die Menschlichkeit zweier Jungen, die geschworen haben, niemals die Hand des anderen loszulassen.
Das ewige Gleichgewicht

Das Haus am Meer ist ein Film über den unaufhaltsamen Lauf der Zeit und gleichzeitig über so etwas wie ein stetig erneuertes Gleichgewicht, ganz im Sinne der ersten Szene, in der die Sonne auf- und ein Mann untergeht. Ein Paar löst sich auf, ein anderes entsteht; ein Mädchen wird vom Meer verschluckt, ein anderes vom Meer ausgespuckt. In einer der eindrücklichsten Szenen des Films stehen Angèle, Joseph und Armand mit den Kindern unterm Viadukt. Die älteren Geschwister rufen ihre Namen, erfreuen sich am Echo. Man versteht, dass sie das schon als Kinder gemacht haben. Die Flüchtlingsgeschwister machen es ihnen überraschend nach, rufen den Namen des verstorbenen Bruders. Tod und Leben, Vergangenheit und Zukunft treffen aufeinander, zeichnen in einer Endlosschleife die Wölbungen des Viadukts nach, in einer der ganzen Menschheit gemeinsamen Sprache.
Der Film steht bis 06.10.2022 in der Arte-Mediathek.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Das Haus am Meer“


Trailer ansehen (2)
Bilder



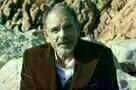
zur Galerie (17 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.













