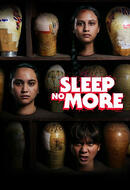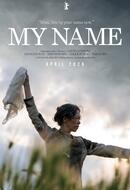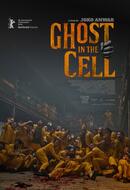La Cocina - Der Geschmack des Lebens – Kritik
Alonso Ruizpalacios serviert einen ambitionierten Film über eine berühmte Restaurantküche in New York – die bietet eine allzu perfekte Metapher für US-amerikanische Einwanderungspolitik.

Nach der Hulu-Erfolgsserie The Bear und Frederick Wisemans Langzeitdokumentation Menus Plaisirs – Les Troisgros, so unterschiedlich sie im Detail sein mögen, könnte man sich zu der These hinreißen lassen: Filme über Großraumküchen liegen im Trend, es gibt offenbar eine Nachfrage. Der mexikanische Regisseur Alonso Ruizpalacios hat der Liste mit La Cocina nun einen weiteren Eintrag hinzugefügt. Konkret handelt es sich um die Küche des New Yorker Restaurants The Grill, ein Touri-Schuppen direkt am Time Square. Die Besonderheit: Fast die gesamte Belegschaft ist nicht in den USA geboren; viele können hier arbeiten, obwohl sie keine Papiere besitzen. So auch die junge Estela (Anna Diaz). Am Anfang sehen wir sie in einer abgehackten Zeitraffersequenz auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch hetzen. Sie wird rasch eingestellt. Dass sie minderjährig ist, spielt keine Rolle mehr, sobald klar ist, dass sie Pedro (Raúl Briones Carmona) kennt, der wie sie selbst aus Mexiko kommt und schon länger bei The Grill die Pfannen schwenkt.
Pedro hat die Kellnerin Julia (Rooney Mara) geschwängert, sie möchte abtreiben und tut das auch. In ihr sieht Pedro einen Ausweg aus seiner marginalisierten Lebensrealität, Stichwort Green Card durch Heirat. Ansonsten interessiert sich La Cocina kaum für diese Figur. In schlüpfrigen Szenen mit Pedro, zu dem nach wie vor eine sexuelle Spannung besteht, darf sie noch schnell die Verführerin spielen. Dafür geht es in den Kühlraum und am Ende tropft Sperma an der Schweinehälfte herunter.
Vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher
Soweit die persönlich-politische Gemengelage. Illegale Migration stilisiert zum Dauerstress in der Küche, der auch den Mythos USA einschließt. Niemand hier glaubt noch an den amerikanischen Traum; das einstige Versprechen Ellis Island spukt in den Gesprächen nur noch als weltfremde Anekdote herum und dem sternenbesetzten Banner streckt man den nackten Hintern entgegen. In diesem Amerika bleibt der Tellerwäscher Tellerwäscher. Äußerst allegorisch ist zu Anfang ein Hummer-Aquarium zu sehen, darin eine Freiheitsstatue in Miniatur – reine Dekoration. Die Hummer kommen später auf den Teller.
Träumen ist ohnehin jenen vorbehalten, die es sich leisten können, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Für die „Illegalen“ bleibt bis auf Weiteres nur die absolute Gegenwart. Da passt es, dass die Handlung sich nur über anderthalb Tage erstreckt. Kochen, Witze erzählen – Filmemachen –, alles eine Frage des Timings. Hin und wieder, vor allem während der Arbeitspausen, in denen die enge Küche verlassen wird (und das 4:3-Format gleich mit), blitzt zwischen den Ausgebeuteten eine trotzige Solidarität auf.
Zurück in der Küche herrscht das reine Durcheinander – von Sprachen, Befehlen und dazwischen das pulsartige Piepsen aus dem Kassensystem. Auch formal geht es zur Sache: Erst die hohe Schnittfrequenz mit rasanten Achsensprüngen und dezentral kadrierten Nahaufnahmen, später aufwändig choreographierte Long Takes bringen ordentlich Druck auf den Kessel. In den Momenten, in denen dieser Druck sich entlädt, kippt der Film ins Groteske – und er tut gut daran. Ruizpalacios scheint sich wenig zu interessieren fürs Subtile.
Disparate Plattitüden
Wenn hier Fährten gelegt werden – halb erzählte Witze, pseudoprofunde Message-Monologe –, kann man sich sicher sein, sie werden später wieder aufgenommen. Das 4:3-Format symbolisiert die klaustrophobische Küchenatmosphäre, in der die Angestellten wie eingesperrt wirken. Tatsächlich arbeiten die Kompositionen gekonnt mit Mehrfach-Rahmungen innerhalb des Bildausschnitts, wodurch sich dieser in kleine Zellen teilt. Darin bewegen sich die Kellnerinnen, deren gestreifte Arbeitskleidung einer Häftlingsuniform ähnelt.
Zu viele Köche verderben bekanntlich den Brei. Es kann aber auch an den Zutaten liegen. Und über interessante Zutaten verfügt La Cocina zwar. Das Problem aber ist, dass Inhalt und Form zu dringend miteinander korrespondieren wollen. Gut möglich, dass Ruizpalacios das Küchen-Setting gewählt hat, weil hier die Salad-Bowl-Theorie als Metapher für die amerikanische Einwanderungspolitik restlos aufgeht. Eine punktuell interessante Ästhetik, allen voran die Bildgestaltung, kann den erwartbaren Stationen einer ausgewälzten Geschichte allerdings nicht mehr hinzufügen als schöne Bilder, denen man ansieht, dass viel über sie nachgedacht wurde. Trotz eines politisch drängenden Themas versteigt sich La Cocina letztlich in disparaten Plattitüden. Immerhin, an Ambition mangelt es nicht.
Neue Kritiken

Ella McCay

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice

Ungeduld des Herzens
Trailer zu „La Cocina - Der Geschmack des Lebens“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (5 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.