L'état et moi - Der Staat und ich – Kritik
Die Systemkritik bekommt System. In seinem dritten Langspielfilm lässt Max Linz einen von Sophie Rois gespielten Komponisten aus dem Jahr der Pariser Kommune in die Gegenwart reisen. L’etat et moi geht’s dabei ums deutsche Strafrecht.

Ein Körper driftet durch die Zeiten und die Tableaus von Max Linz, seines Zeichens DFFB-Absolvent, Systemkritiker, Regisseur zweier kluger und witziger Filme über den Kultur- und den Universitätsbetrieb. Der Körper gehört Sophie Rois, die Tableaus gehören zu Linz’ neuem Film L’etat et moi, und Erstere spielt in Letzterem eine schön genderflexible Doppelrolle als 19.-Jahrhundert-Komponist Hans List mit Zeitreisekompetenz und als Richterin Praetorius-Camusot im heutigen Berlin. Das Transit-hafte Bild mit Kutsche und moderner Polizeiwanne ist vielleicht eine der wenigen Verbindungen zwischen dem neuen DFFB-Diskurskino und der sogenannten Berliner Schule.
Ein Komponist in der Kommune
List ist, wie gesagt, Komponist, aber die Leute verstehen immer Kommunist (der Gag wird totgeritten, bis er schon wieder so lustig ist, dass er schon wieder nicht mehr lustig ist), was nicht ganz falsch ist, weil sich List im Jahre 1871 auch der Pariser Kommune anschließt. Ja, es wird sogar geschossen in L’etat et moi! 1871, das ist zugleich das Jahr, in dem das Strafgesetzbuch in Deutschland seinen Dienst antritt, und dieser Zusammenhang war Linz Inspiration für seinen dritten Langspielfilm, in dem es erstmals hinaus aus den geschlossenen Betrieben in die Geschichte, in die Vergangenheit geht. Den Dingen wird hier nicht nur in ihrer neoliberalen (dieses Attribut passt auf die beiden anderen Linz-Filme trotz aller Verkürzungsgefahren dann doch ganz gut) Akutgestalt auf den Grund gegangen, sondern in ihren Ursprüngen.
Die Juristerei und ihre inhärenten Widersprüche stehen im Zentrum des Films, aber auch Theater wird gespielt, auch um die Kultur geht es wieder: List schmuggelt sich, in der Berliner Gegenwart angekommen, als Komparse in die Inszenierung seines eigenen Stücks Die Elenden am Berliner Staatstheater. Formal ist wie immer bei Linz postdramatische Verfremdung auch auf der Leinwand das Gebot der Stunde, wie immer wird der Film zwischendurch musikalisch angezündet, noch mutiger als sonst geht es albern und slapstickhaft zu. Das Schönste an L’etat et moi ist vielleicht, wie er an den Stummfilm denken lässt.
Hinter jedem Gag ein Gedanke

Warum empfinde ich dann aber doch ein Ungenügen bei diesem Film? L’etat et moi ist wohl auch wegen seiner Entgrenzung von Raum und Zeit Linz’ bislang offenster, freister, verspieltester Film, und vielleicht ist Linz einer der wenigen Filmemacher, bei denen das nicht unbedingt eine gute Nachricht ist. In den Vorgängern rieb sich das Anarchische und Alberne stets an hermetischen Systemen, der scharfzüngige Witz ergab sich fast eigenlogisch aus dem zwar verfremdeten und überspitzten, aber doch präzisen Blick auf einen Betrieb. Der Betrieb in L’etat et moi heißt vielleicht einfach, wie der Name schon sagt, deutscher Staat. Das erhöht gewissermaßen die stakes: Nicht nur innersystemische Widersprüche, auch historische Zusammenhänge liegen auf dem Seziertisch, es sind klarere Setzungen im Spiel, und im Hintergrund hört man noch die Recherchemühlen mahlen.
Bei diesem Kaliber wird dann vielleicht doch zum Problem, wie genau alles trotz breiterem Sujet, trotz offenerer Motivik sitzt. Wie jedem gegen die Pointe gebürsteten Gag ein kluger Gedanke zugeordnet scheint, den zu suchen ich mich dann doch aufgefordert fühle, was weder dem Gag noch dem Gedanken guttut. Zwar waren Linz’ Filme nie Verführmaschinen. Aber während ich sonst das Gefühl hatte, da existiere eine filmische Welt, die eine Realität zur Kenntlichkeit verzerrt, wirkt die filmische Welt von L’etat et moi auf mich manchmal wie die fiktionale Übersetzung eines Essayfilms, den ich vielleicht doch lieber im Original gesehen hätte.
Hat das schon System?

Eh klar: Wer etwas wagt, kann scheitern, und zu scheitern ist besser als nichts zu wagen. Vielleicht ist das Schöne an L’etat et moi auch gerade nicht das Neue, sondern das Wiedererkannte, die Beharrlichkeit, mit der Linz und seine DFFB-Mitabsolvent*innen wie Julian Radlmeier und Susanne Heinrich die Suche nach der Wiederaufnahme zu Unrecht zugewachsener Pfade der Filmgeschichte im Dienste einer politisch radikalen Gesellschaftskritik fortführen. Vielleicht sollte man Linz’ neuen Film weniger mit seinen anderen vergleichen denn als Neuankömmling in einem weiterhin spannenden Werk willkommen heißen. Andererseits lauert hinter der nächsten Ecke dieses Gedankengangs dann auch schon wieder ein Problem. Denn diesem Werk-Werden einstiger (augenzwinkernd, aber immerhin) revolutionärer Impulse wohnt zwar einerseits ein schönes Versprechen, andererseits natürlich die Gefahr inne, dass die Sache einfach irgendwann selbst System hat.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „L'état et moi - Der Staat und ich“


Trailer ansehen (2)
Bilder
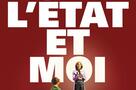



zur Galerie (4 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.









