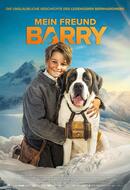Kopfplatzen – Kritik
VoD: Es gibt keinen gesunden Abstand. In Kopfplatzen versucht ein Pädophiler den qualvollen Konfrontationen des Alltags auszuweichen.

Markus ist ein junger, attraktiver Mann Ende zwanzig. Er arbeitet in einem Architekturbüro, macht Sport mit Kumpels, besucht die Familie seiner Schwester zu Familienfesten – und ist doch ein Einzelgänger. Von Anfang an lernen wir ihn in einer Art permanentem Ausweichmanöver kennen, einer Habachthaltung, in der er durch sein eigenes Leben schleicht. Markus ist pädophil. Bisher lebt er seine sexuelle Neigung aus, ohne handgreiflich geworden zu sein. Allein, zu Hause hinter zugezogenen Vorhängen, am Bildschirm oder in der Dunkelkammer, wo er seine heimlich aufgenommenen Schwimmbadfotos entwickelt. Er hat sich im Griff – noch. Er spürt jedoch, dass er eine zunehmende Gefahr darstellt, die er im Zweifel nicht mehr kontrollieren kann. Diese Zerrissenheit zwischen moralischer Selbstkontrolle und Verlangen treibt ihn mehr und mehr in eine ausweglose Verzweiflung. Insbesondere als die alleinerziehende Jessica mit ihrem Sohn Arthur in die Wohnung unter ihm einzieht und sich ein riskantes Beziehungsgeflecht entwickelt.

Norm und Normalität
Autor und Regisseur Savaş Ceviz zeichnet in seinem Spielfilmdebüt Kopfplatzen das Psychogramm eines Menschen, der in einer scheinbaren Normalität lebt. Routinen und Kleinigkeiten wie Kaffeetrinken, Kuchenessen, ein Blick, ein Atemzug, eine Umarmung, werden in Nahaufnahmen erzählt und dadurch in ihrer Fragilität präsentiert, denn jeder Moment wird von der subtilen Gefahr untergraben. Ceviz arbeitet dabei kaum mit Totalen, ist immer nah, halbnah oder im Close-up an den Gesten und Körpern seiner Figuren. Man hat förmlich das Bedürfnis nach mehr Abstand, möchte, ebenso wie die Hauptfigur, den qualvollen Konfrontationen des Alltags ausweichen. Mehr noch als Max Riemelt in der Rolle des Markus überzeugt vor hier allem der junge Oskar Netzel. Er verleiht der Figur des achtjährigen Arthur eine Leichtigkeit und Zugänglichkeit, die das Dilemma von Markus nur umso mehr unterstreicht. Es gibt keinen gesunden Abstand.

Die Dramaturgie in Kopfplatzen speist sich aus der steigenden, inneren Zerrissenheit von Markus. Diese entwickelt sich analog zu einer Tiermetapher, die sich durch den Film zieht. Immer wieder sehen wir Markus, wie er durch das Gitter eines Wildgeheges einen Wolf beobachtet. Zunächst ist dieser zahm, fast zutraulich, wird jedoch immer reizbarer. In einer Szene labt sich der Wolf an einem rohen Stück Fleisch. Die Bestie hat Blut geleckt und kann von ihrer Beute nicht mehr ablassen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das Raubtier aus seinem Käfig befreit.
Die Macht der Blicke

Jedoch legt Ceviz die Handlung so an, dass deutlich wird: Es geht nicht nur um einen sexuellen Trieb, sondern auch um emotionale Bedürfnisse. Fast schon provokativ erscheint ein Nietzsche-Zitat, das sich Markus wie einen alles erlösenden Merksatz auf einem Zettel notiert hat: „Was aus Liebe getan wird, geschieht immer jenseits von Gut und Böse.“ Dabei drängt Ceviz auf keine eindeutige Auflösung seiner Geschichte, weder in therapeutischer Sicht noch juristisch oder philosophisch. Die Handlung bleibt stets angespannt, jedoch verhalten, ja kontrolliert. Die potenzielle Gefahr immer im Blick. Wir beobachten die Hauptfigur, ihre Blicke, die nicht loslassen können. Gebannt, ob Markus den alles entscheidenden Fehler macht. So sehen wir einen Menschen, der in einem finalen Akt die Ausweglosigkeit seiner Situation beschreitet, indem er die verlorene innere Ordnung im Äußeren herstellt. Zurück zur Normalität. Was bleibt, ist ein weißes Hemd, frisch gewaschene Hände und die bleierne Frage, kann es eine Schuld in der Unschuld geben – und umgekehrt?
Die Grenzen des Menschlichen sehen

Die Zerrissenheit, die die Hauptfigur durchlebt, lässt sich in Kopfplatzen auch auf einer übergeordneten Ebene verstehen: Jeder Mensch ist demnach ambivalent. Man kann nicht einfach in Gut und Böse unterteilen. Wir haben alle unsere psychologische Prädestination, unseren Schatten, über den wir nicht springen, unsere Haut, aus der wir nicht können – und im besten wie im schlimmsten Fall, genau wie Markus, ein Bewusstsein für unsere Abgründe. Genau in diesem Bewusstsein liegt die Tragweite des persönlichen Dilemmas begraben. Damit wird das Thema Pädophilie nicht etwa verharmlost oder gar mit einer pseudo-philosophischen Esoterik des „Nobody is perfect“ verwaschen. Aber Kopfplatzen zeigt, wie das Kino zur Projektionsfläche für Themen werden kann, die sich so unsichtbar in jedem Einzelnen von uns und im Kollektiv unserer Gesellschaft abspielen, dass sie die große Leinwand brauchen, um gesehen und verstanden zu werden.
Der Film steht bis zum 15.09.2021 in der ARD-Mediathek.
Neue Kritiken

No Bears

Scarlet

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother
Trailer zu „Kopfplatzen“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (9 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.