Joan Baez: Mit lauter Stimme – Kritik
Im Dokumentarfilm Joan Baez: I Am a Noise über die berühmte US-Sängerin wird nicht nur in Rock-’n’-Roll-Nostalgie geschwelgt. Die Künstlerin ringt vor der Kamera mit falschen Wahrheiten und alten Dämonen.

Der Film beginnt mit ihrer Stimme: „Freedom, oh freedom …“, singt Joan Baez in ihrem unverwechselbarem Sopran, während die Kamera ganz dicht an ihrem Gesicht klebt; eine Schwarzweißaufnahme von einem Konzert aus den frühen Sechzigern. Es folgt eine Texteinblendung: „Everybody has three lives: the public, the private and the secret“ – ein Zitat von Gabriel García Márquez, dann der Schwenk über ein Lager mit stapelweise Tonbandaufnahmen, Fotokisten, Tagebuchkladden, Zeichnungen. Auf einer der Kisten klebt ein Post-it mit der Aufschrift: „Therapy Tapes“. Wieder hören wir ihre Stimme, diesmal spricht Joan Baez über verschüttete Erinnerungen und wie verlässlich das Gedächtnis eigentlich ist. Dazu sehen wir, wie sich ein Tonbandgerät dreht. Erst dann landen wir in der Gegenwart. Aus der Vogelperspektive nähert sich die Kamera Joan Baez’ Haus in Kalifornien: hohe Bäume, ein verwunschener Garten, schillernde Kolibris, ein zotteliger Hund, rote Rosen, türkisfarbener Pool, in dem die Sängerin ihre Bahnen zieht, bevor sie den Voice Coach trifft. Sie bereitet sich auf ihre Abschiedstour vor. Wir schreiben das Jahr 2019, Baez ist 79 und will ihre Karriere mit einer letzten Tournee beenden. Dazu braucht sie Hilfe für ihre erschlaffenden Stimmbänder.
„I’m not a saint, I am a noise!“

Die Tour, die die Singer-Songwriter-Legende noch einmal auf Bühnen in Alabama, Paris, Istanbul und New York bringt, bildet den äußeren Rahmen des Dokumentarfilms von Miri Navasky, Maeve O’Boyle und Karen O’Connor. Das Herzstück jedoch ist Baez’ privates Archiv: Tagebücher, Zeichnungen, Homevideos, vor allem aber Tonbandaufnahmen, in denen sie über ihre Familie, ihre Ängste und Zweifel spricht, Dinge in ihrem Leben, über die sie lange geschwiegen hat. Gerade dieses Archivmaterial macht Joan Baez: I Am a Noise zu etwas Besonderem. Statt Altersweisheiten eines Rockstars runterzubeten, stellt sich die Sängerin ihren Dämonen. Sie legt ihr Innerstes offen. Und wirkt dabei erstaunlich entspannt und unsentimental, „at peace“, würde man in Amerika sagen. Wohl auch das Ergebnis jahrzehntelanger Psychotherapien, von denen viele der Audiotapes stammen.
Baez wächst mit zwei Schwestern in einem weltoffenen Quäker-Haushalt auf. Der Vater ist Physiker, die Familie zieht häufig um, lebt in New Mexico, Rom und Bagdad, bevor Albert Baez eine Stelle als Dozent am MIT in Boston findet. Aus der Zeit stammen Filmaufnahmen von der scheinbar glücklichen Familie, Mädchen, die auf den Roadtrips rumalbern, gemeinsam im Auto singen, vor der Kamera turnen. Doch etwas Düsteres überschattet die Idylle. Joanie leidet an Angstzuständen, ist hyperaktiv, fällt immer wieder in tiefe Depression. Mit 16 wird sie erstmals zum Psychiater geschickt. Ihre Gefühlsstürme hält sie in Tagebüchern und anrührenden Zeichnungen fest: Selbstporträts mit weit aufgerissenen Augen, Kinder im Würgegriff einer Löwenfigur, Wölfe, ein winziges Mädchen auf einer grell erleuchteten Bühne. Im Film nehmen diese Dokumente eine wichtige Rolle ein. Immer wieder werden Sätze aus den Tagebüchern hervorgehoben, so auch ihr Eintrag: „I’m not a saint, I am a noise!“. Die Zeichnungen entwickeln als animierte Figuren im Film ihr Eigenleben. Und bilden den verborgenen, verletzlichen Gegenpol zum öffentlichen Bild von Joan Baez, dem Star mit der goldenen Stimme und dem unfehlbaren moralischen Kompass.
„Besser in Eins-zu-2000-Beziehungen“

Als Teenager in Cambridge findet Joan den Weg zur Musik. Gitarrenspielen und Singen hatte sie sich selbst beigebracht. Jetzt spielt sie in Studentenkneipen erstmals vor Publikum. Mit Erfolg. Sie wird zum berühmten Newport-Festival eingeladen, nimmt erste Soloalben auf und landet mit 18 auf dem Titel von Time Magazine. Plötzlich ist sie berühmt – und kämpft weiter mit ihren Angstzuständen. Es kommt zu Eifersüchteleien und Zerwürfnissen mit ihren Schwestern. 1961 lernt sie Bob Dylan kennen. Der näselnde Sänger ist damals noch fast unbekannt. Sie tritt mit ihm auf, die beiden werden das It-Couple der Musikszene. Es ist die Zeit der Bürgerrechtsbewegung. Joan Baez demonstriert gegen Rassismus, solidarisiert sich mit Wehrdienstverweigerern. Sie heiratet David Harris, einen der Köpfe der Anti-Vietnamkriegs-Bewegung. Ihr Mann sitzt im Gefängnis, als sie auf dem Woodstock-Festival auftritt – hochschwanger mit dem gemeinsamen Sohn. All das dokumentiert der Film mit historischen Filmmaterial. Doch es sind die Szenen aus der Jetztzeit, in denen Baez sich selbstkritisch mit ihrer Rolle als Popstar, Aktivistin und Mutter auseinandersetzt, die der Doku Tiefe verleihen. Etwa wenn sie erzählt, dass ihr Weltrettungs-Engagement auch eine Art Sucht war, Ablenkung von familiärer Verantwortung und engeren persönlichen Bindungen. „Ich war nicht gut in Eins-zu-Eins-Beziehungen“, sagt sie. „Besser in Eins-zu-2000-Beziehungen.“ Das bestätigt auch ihr Sohn Gabriel, der als Kind unter der Abwesenheit der aktivistischen Mutter litt.
„The demons still come and go“

Aber der Film wühlt nicht nur in düsteren Gefühlsschubladen. Zwischendurch zeigt er auch die heitere, selbstironische Seite des Stars. Wir sehen Joan Baez beim Bügeln in der Garderobe vor einem großen Auftritt. „So glamourös kann das Bühnenleben sein“, sagt sie mit einem Lachen. In Paris tanzt sie ausgelassen zum Sound einer Straßenkapelle, während Passanten verblüfft ihre Handys zücken. Das dunkelste Kapitel schlägt der Film auf, als Baez über das Trauma ihrer jüngeren Schwester Mimi spricht. Mimi glaubt, dass ihr Vater sie sexuell missbraucht hat. Ein schockierendes Bekenntnis, das die Familie zerreißt und auch die Sängerin aus der Bahn wirft. In einer Tonbandaufnahme hören wir, wie sie ihren Vater konfrontiert. Er redet sich raus, spricht von verantwortungslosen Psychologen und „False Memory Syndrome“. Spätestens da bekommen die glänzenden Bilder vom Familienidyll einen tiefen Riss. Zum Zeitpunkt des Filmprojekts sind Baez` Eltern und auch ihre Schwestern schon länger tot. Doch die Frage, was wirklich geschah und warum Vater und Mutter den Vorwurf immer vehement bestritten, beschäftigt Joan Baez bis heute. „The demons still come and go“, sagt sie.
Die Dämonen sind immer noch da. Das ist vielleicht die größte Stärke des Films. Dass er keine einfachen Wahrheiten liefert, zu keinem erlösenden Psycho-Fix kommt, kein demonstratives Me-Too-Hashtag setzt. Joan Baez. I Am a Noise erzählt die Lebensgeschichte der Folk-Legende leise und tastend – und kommt dem Menschen hinter der Star-Fassade gerade dadurch erstaunlich nah.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Joan Baez: Mit lauter Stimme“

Trailer ansehen (1)
Bilder



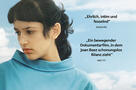
zur Galerie (8 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.








