Vom Gießen des Zitronenbaums – Kritik
Auf manche Filme reagiert man allergisch. Elia Suleimans Vom Gießen des Zitronenbaums gehört für Frédéric Jaeger dazu.

Drei Dinge muss man über Vom Gießen des Zitronenbaums (It Must Be Heaven) wissen. Erstens: Es ist ein Film, der die Zentralperspektive liebt, der sich die Welt so arrangiert, dass der beobachtete Gegenstand oder Mensch in der Mitte steht, der die Kamera frontal auf ihn richtet und dabei möglichst viel Symmetrie herstellt. Zweitens: Der 58-jährige palästinensische Regisseur Elia Suleiman spielt sich selbst in der Hauptrolle, inszeniert sich als beinahe komplett stummen, älteren Mann mit Hut, der die Welt im Blick hat, sich mit seinem leicht ironischen Lächeln aus ihr herauslöst, über ihr schwebt, alles checkt. Drittens: Narrativ geht es dem Film um die anarchische Infragestellung der Autoritäten in der Welt, konkret in Paris und in New York, wo er die normierenden Kräfte und den Kontrollwahn von Polizei und Produzenten vorführt.
Lieber nicht zu diskursiv

Vom Gießen des Zitronenbaums ist ein Film mit Botschaft: Palästina ist überall, ruft er einem entgegen. Ganz klar ist nicht, was das heißt, denn diskursiv will der Film lieber nicht allzu deutlich sein. Die Entfremdung, die im Mittelpunkt steht, passt jedenfalls zu der Idee, dass eine Belagerung durch den Staat vielerorts stattfindet und dass manche Menschen konsequent an den Rand gedrängt werden. Exemplifiziert wird das durch viele Szenen mit Polizisten, die in Formationen ihre Arbeit verrichten. Zum Beispiel messen sie in einem Pariser Café die Größe der Bestuhlung aus. Während Suleiman mitten auf der Terrasse sitzt, ungerührt nach vorne blickt, stellen sich die Polizisten vor ihm auf. Sie ignorieren ihn. In einer militärisch anmutenden Choreografie bewegen sie sich an ihre Positionen, um synchron zueinander die Maße zu nehmen.
Zu Hause in Nazareth wird Suleiman immer wieder als Nachbar angesprochen. Er beugt sich, mittig im Bild, über die Balustrade seines Balkons und schaut in seinen Garten. Der Nachbar steigt aus seinem Zitronenbaum mit einer Tüte voller Früchte. Der Regisseur guckt ihn fragend an. Der Nachbar erklärt sich. Suleiman bleibt stumm. Die komische Welt performt um ihn herum, damit er etwas zu beobachten und zu belächeln hat. Vom Gießen des Zitronenbaums illustriert gewissermaßen seine solipsistische Perspektive, nach der alles allein für ihn geschieht. Es ist die Selbstüberschätzung des Künstlers, man kann es aber auch als dessen Ehrlichkeit verstehen: Direkt erfahren kann er ja nichts anderes als seine eigene Sichtweise.
Ansteckende Apathie

Das Absurde als Choreografie muss man mögen, will man etwas mit diesem Film anfangen können. Jacques Tati könnte Pate gestanden haben, oder auch Roy Andersson. Mir scheint Suleimans filmische Position aber recht losgelöst von ihnen. Seinem Kino geht die Schärfe und Offenheit von Tati ab, und er hat weder die Neugierde noch das Interesse am Sezieren, das ich mit Andersson verbinde. Sein eigener müder Blick findet ununterbrochen in den Szenen vor seinen Augen eine Entsprechung. Seine Apathie ist ansteckend: Dass er mehr auf Humor setzt als auf explizite Politik, erklärt Gael García Bernal (als er selbst) vor einer potenziellen Produzentin, die Suleiman natürlich sofort abblitzen lässt. Nicht böswillig, sondern beiläufig, denn mit ihm muss man sich nicht weiter beschäftigen. Spricht daraus Bescheidenheit? Ein Eindruck, der narrativ naheliegt, den Suleiman filmisch aber aushebelt.

Indem sich der Regisseur selbst als Stellvertreter des Zuschauers setzt, macht er zwar seine Subjektivität transparent, setzt aber auch die als absurd entlarvten Settings mit seiner Wahrnehmung gleich: Nur er kann die Welt so sehen, wie sie ist. Das wirkt auf mich zunächst einmal vor allem unsympathisch, was mindestens jene anders sehen dürften, die diese Verabsolutierung der einen Perspektive als einen Akt des Widerstands lesen. Unglücklich erscheint mir der Widerspruch zwischen der ästhetischen Setzung des Films und dem, was er schildert und bebildert, nämlich die Absurdität von Normvorstellungen, von Machtausübung und Autoritäten. Er tut so, als sei die eigene Subjektivität total gesetzt ein sinnvolles Mittel des anarchischen Bruchs, dabei ist gerade das autoritär. So steckt im Kern seiner Erzählweise ein performativer Selbstwiderspruch. Aber absurd wollte der Film ja ohnehin sein.
Neue Kritiken

Primate

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail
Trailer zu „Vom Gießen des Zitronenbaums“

Trailer ansehen (1)
Bilder
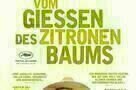



zur Galerie (7 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.













