Irgendwann werden wir uns alles erzählen – Kritik
Jeder muss sein altes Leben hinter sich lassen. Emily Atef begibt sich auf einen ostdeutschen Bauernhof im Nachwendesommer und sucht nach so großen Gefühlen und Wendungen, wie es sie nur im Kino gibt. Das Wunder ist, dass das wirklich hinhaut.

Etwas gewöhnungsbedürftig ist der Einstieg schon: Jedes Bild in Emily Atefs breitformatigem Film Irgendwann werden wir uns alles erzählen ist durchflutet von Sonne und Sommer. Ständig legt sich ein goldener Schein über die Gesichter, über das nicht benannte ostdeutsche Land, das eigentlich nur Sachsen oder Thüringen sein kann, das sich schon in der Währungsunion befindet, aber eben noch nicht in der BRD. Das erste Bild landwirtschaftlicher Arbeit ist mehr sozialistischer Realismus als soziale Realität. Kaum ein, vielleicht gar kein Ton, der nicht nachsynchronisiert ist, der nicht sofort mehr Hörbuch als direktes Wort ist. Auch die Sätze selbst: betont literarisch geschrieben, geschwollen verfasst und vorgetragen. „Ich mag die Sehnsucht in deinem Blick“, so etwas sagt man sich hier wie selbstverständlich.

Und keine Figur, die nicht immer schon ein bisschen ihre eigene Vorfertigung ist. Maria (Marlene Burow) wandelt durch diese Bilder, wie es sich für eine 19-Jährige im Film gehört, die nicht weiß, ob der Besuch der Schule oder was überhaupt noch Sinn macht: in sich versunken, oft ganz still, in den richtigen Momenten forsch. Mit ihrem Freund Johannes (jedes Wort lässt mich schmunzeln: Cedric Eich) wohnt sie auf dem Dachboden des Bauernhofes seiner Familie. Und er weiß genau, wo es hingehen soll: Mit seiner idealistischen Leidenschaft für die Kunst wirkt er mehr wie ein Prinz aus dem Sturm und Drang denn wie ein Bauernjunge. Verkündet seine Entscheidung für die Kunsthochschule gegenüber der Freundin mit einer Aufregung wie Romy Schneider gegenüber Karlheinz Böhm. Nachbar Henner (Felix Kramer) hingegen strömt die archaische Bauernmännlichkeit aus jeder 40-jährigen Pore, er hat zwei gefährliche Hunde, betrinkt sich gerne, schiebt den Trabi fast eigenhändig aus dem Graben. Und die Älteren, die Omi, die Mutti, der Volker und all die anderen sind natürlich auch noch da.
Feierlicher Ernst

Kein Zweifel, dass Emily Atef mit ihrem neuen Film nach so großen Wendungen, Gefühlen, Handlungen, bekannten Figuren sucht, wie es sie eigentlich nur im Kino oder in der Literatur gibt. Kamera, Drehbuch, Darsteller, Score: Alles, was da ist, wird zu wuchtigen Dimensionen geweitet, wenn der vorprogrammierte Konflikt in Fahrt kommt. Was zwischen Maria und Henner als Übergriff anfängt, wird erst zum Lust- und Versteckspiel vor den anderen, dann zur ehrlichen Romanze, dann zur veritablen Tragödie. Emily Atef setzt eine Geschichte von Verführtwerden und Verführtwerdenwollen, von roughem Sex und zärtlichen Berührungen mit viel Kinosinn ins Bild und sucht dabei ganz bewusst nach den ebenso großen Referenzen: Hier wird sich in Dostojewski versunken, werden Trakl-Gedichte vorgelesen, werden sich Briefe der verbotenen Liebe geschrieben, übernachtet man heimlich im Haus eines älteren Mannes und erzählt, man wäre zu seiner Mutter gereist, fällt dabei ins Fieber der Leidenschaft und pflegt sich wieder gesund, als wäre man in einem Roman von Jane Austen.

Und all das mit feierlichem Ernst: Es ist deswegen ein kleines Wunder, dass Irgendwann werden wir uns alles erzählen auch wirklich hinhaut, sich wirklich zu einer symphonischen, stimmigen Erzählung über die Wende verdichtet. Emily Atef entfaltet eine Geschichte über die Irrungen und Wirrungen des Privatlebens in Verbindung mit einer wackelnden Ordnung der Öffentlichkeit, wie aus dem russischen Realismus eines Tolstoi. War der Zusammenhang etwa bei Anna Karenina durch den Adel gegeben, ist er es hier durch die Bürgerschaft eines untergehenden Staats, der zu alter Form verwächst. Und so fallen hier nicht wendekitschig Deutsche in deutsche Arme, sondern ist das Wiedersehen befremdlich vertraut, sind die Gesichter ab- und die Körper zugewandt, gibt es Handschläge als offizielle Vorstellung zwischen Oma und Enkeln.
Maximal ausgeweitetes Coming of Age

Überhaupt findet Atef paradoxerweise mit dramatischer Überhöhung einen Weg, die Extreme zu vermeiden: Weder gibt es hier die große Depression des Zusammenbruchs noch den Aufbruch in den neuen. Keiner weiß, in welches Leben von hier aus gestartet werden könnte, wie die Zukunft des Bauernhofs aussehen kann, ob man sich traut, mit dem alten Leben in der neuen Welt zu bestehen oder sich das Öko-Abzeichen aus Bayern holt und es mit einem Bio-Bauernhof versucht. Auch Marias Mutter (Jördis Triebel) sitzt zu Hause fest, wartet im Garten auf das neue Leben wie ihre 19-jährige Tochter am Esstisch ihrer Schwiegereltern.

Jeder muss ein altes Leben hinter sich lassen. Noch Johannes’ Oma hat Angst vor dem Ausland, das Bayern heißt, und davor, das erste Mal mehr als drei Tage lang nicht zu Hause zu sein. Irgendwann werden wir uns alles erzählen wird irgendwann von all dem erzählt haben: ein bisschen auch als Erotikdrama, als ausdrücklich selbstbewusste Verfilmung von Daniela Kriens gleichnamigem Roman, als Tragödie deutscher Romantik und auch als klassisches Coming of Age, das sich ausnahmsweise mal nicht nur auf die Teenager einer Geschichte konzentriert, sondern seine Genreregeln angesichts einer Ausnahmesituation auf noch jeden ausweitet: Alle stehen hier an der Schwelle, etwas Neues zu werden, und wenn diese Schwelle eben die deutsch-deutsche Grenze ist.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“

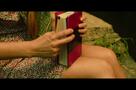
Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (8 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.


















