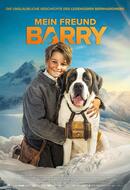In die Sonne schauen – Kritik
Jahrhundert in psychischen Innenräumen: Mascha Schilinskis brillantes Filmgedicht In die Sonne schauen inszeniert auf einem Bauernhof ein Spiegelkabinett der Geister und Echos, das von der Gewalt kündet, die im patriarchalen System steckt.

Die Geister, die in diesem Vierseithof hausen, hat niemand gerufen. Sie sind da, von Anfang an, sie gehen ein, aus und um. Werden festgehalten, verschwinden, kehren wieder als das Verdrängte. Festgehalten: schon in einer Fotografie. Sie zeigt ein Mädchen auf einer Couch, zur Seite gekippt wie eine Tote, Alma ihr Name. Neben der Couch, da und nicht da, eine Person, unscharf, ein Geist, den das Aufzeichnungsmedium festhält, oder hervorbringt. Wiederkehr, später: Alma (Hanna Heckt), eine andere Alma, auch blond, der Toten ganz ähnlich, betrachtet dieses Bild von einer, die sie selbst ist und nicht ist. Ein Reenactment wird folgen, wie überhaupt vieles in diesem Film im Bann der Übertragung und des Wiederholungszwangs steht.
Großes Geschrei, dumpfer Aufschlag

Alles auf engem, verdichtetem Raum zumeist, in diesem Hof als haunted house, in dem die Menschen und die Zeiten umgehen, in wiederkehrenden Räumen und Konstellationen. Hinaus dagegen geht es recht selten, schon gar nicht in irgendeine Ferne, aber eindrücklich und nicht weniger haunted aufs angrenzende Land, ins Wasser, den Fluss an der Grenze, aufs Feld. Frühe Szene, die mit den Räumen bekannt macht, ein hartes Gegeneinander von Stopp und Bewegung: Die Schuhe einer Magd werden von den Kindern auf eine Schwelle genagelt. Sie schlüpft hinein und stürzt vornüber, liegt da wie tot. Die Kinder blicken durch eine Glastür (die Subjektiven in diesem Film sind eine Geschichte für sich), nähern sich der Bewegungslosen, sie belebt sich und jagt, die Kamera hinterher, die Kinder von Zimmer zu Zimmer durch das Haus, und zwar im Kreis. Das ist die Bewegung des Films, im Kreis, Lebende, Tote, scheinhaft Belebte und lebende Tote, die durch ein Jahrhundert in diesem Vierseithof hausen.

Vier Geschichten, vielmehr Schichten. In sich ist ein Moment, eine Szene nach der anderen ansatzlos unerklärt impressionistisch, untereinander sind sie in ausgezirkelten Spinnenfäden verwebt, die Verbindungen bleiben oft implizit, der Wechsel der Zeiten nicht durch formale Mittel, etwa Einblendungen, sondern nur durch Requisite und Kostüm und am Anfang des Jahrhunderts noch die Sprache der Altmark, ein untertitelungsbedürftiges Platt, signalisiert, nicht auseinander, sondern ineinander sortiert. Die Zeit des Ersten Weltkriegs, Fritz, der Sohn, was aber, aus den Augen des Mädchens, unbegriffen beobachtet wird, stürzt sich vom Scheunenboden, großes Geschrei, dumpfer Aufschlag, die Amputation des Beins, die notwendig wird, rettet ihn vor dem Tod auf dem Schlachtfeld. Der Stumpf, der nackte schlafende Mann, seine Haut und die Haare darauf, der Schweiß, sind ein körperliches, sinnliches, sexuelles Faszinosum für Erika (Lea Drinda), die Nichte des Manns, Jahrzehnte später. Sie nimmt seine Krücken und humpelt in der Imitation seiner Behinderung über den Gang, das eine Bein hochgebunden: illegitimer Nachahmungsdrang. Der Vater ruft aus dem Hof, Blick durch das Fenster. Sie befreit ihr Bein, stellt die Krücken zurück, geht in den Hof, wo es, als wäre es für diese jugendliche Übertretung, eine schallende Ohrfeige setzt.
Kitzel des Todes

Noch einmal Jahrzehnte später, DDR-Jugend auf dem Land. Angelika (Lena Urzendowsky) als Teen auf dem Hof, eine Meisterin des Übertretens auch sie, nicht wehrlos gegen den Onkel, der sie bedrängt, und den Cousin, der sanfter an ihr interessiert ist. Verschiebung des Sexuellen in ein Spiel mit Aalen, die in wilder Fahrradfahrt aufgeschnappt werden, Aalen, die durch die Zeit hindurch beißen. Später verbirgt sich Angelika auf dem Feld, in einer Kuhle, den Blicken entzogen, es ist das Gegenteil eines Schutzraums, denn man sieht den Mähdrescher, der sich tödlich nähert. Ein Mädchen sitzt an anderer Stelle im 20. Jahrhundert in einem Baum, hat sich dort oben versteckt, und niemand hört, wie sie ruft.

Es sind solche Szenen als Wunsch- oder Alpträume vom Kitzel des Todes untergemischt. Träume, die der Film mitträumt, weil er sich programmatisch den subjektiven Wahrnehmungen seiner Protagonistinnen verschreibt, auch die Voiceover-Stimmen sind nicht objektive Erklärspur, sondern nur eine weitere Schicht - diese Subjektivität aber ist kein Vorwand, um selbst vage zu bleiben, sondern wird durchweg überführt in eine ausgeklügelte Kunstform, bei der jeder durch Spalt und Tür erhaschte Blick auf einen rätselhaft bleibenden Vorgang ein Echo, einen visuellen oder auditiven Reim (“warm”), eine Spiegelszene an anderer Stelle hat. Es ist eine präzise Komposition der Durchlässigkeiten: nicht nur zwischen den Figuren und ihren Geschichten und Blicken, ihren Verletzungen, Fantasien und Toden und zwischen den Zeiten, sondern auch zwischen dem, was man sich als real vorstellen muss, und dem, was Fantasien sein dürften.
Wider das Dominanzkino

In die Sonne schauen ist ein Film, der ein Jahrhundert in psychischen Innenräumen erfasst, aber nicht als Epos, sondern als Lyrik in gebundener filmischer Form. Das Bild geht nicht in die Breite, sondern ist fotografisch kompakt (1: 1,37), nahe am klassischen 9:13-Fotoformat, die Tonspur eine ihrerseits mit äußerster Sorgfalt gemachte Sache für sich: das ständige Knistern, das zum Feuer führt als verzehrender Kraft, aber zugleich das leise Knacksen von Vinylplatten evoziert, das auditive Aufzeichnungsmediumäquivalent zur Fotografie, das seine eigenen Geistererscheinungen hat. Von Zeit zu Zeit dunkel wummernder Krach, deutlichster Ausdruck eines Horrors, der sonst eher in den Fugen des Films bleibt.

Kein Geheimnis macht In die Sonne schauen aus dem Generalbass seiner Erzählung - es geht durchweg um die Gewalt, die im patriarchalen System steckt, um Geschichten der Traumatisierung, die sich durch die Generationen weniger vererben als im Wandel der Zeiten und Sitten gleichen, wiederholen, wandeln und dabei durchaus auch mildern. Das Ganze ist schon auch eine Kontrafaktur zu Michael Hanekes Gewaltursachenforschungsetüde Das Weiße Band. Eine Kontrafaktur, die ihrerseits zwar konzeptuell konsequent und genau ausgearbeitet ist, dabei aber aus der gebundenen Form eine eigene Freiheit entbindet. Eine Freiheit der weiblichen Subjektiven im buchstäblichen und übertragenen Sinn, bei der jede Einstellung die Abweichung und den Widerspruch zum herrschaftlichen Blick des auch von Haneke verkörperten Dominanzkinos sucht.
Neue Kritiken

No Bears

Scarlet

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother
Trailer zu „In die Sonne schauen“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (15 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.