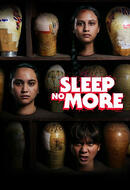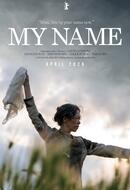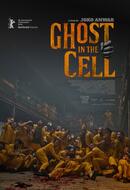How to Be Normal – Kritik
Die junge Pia ist umgeben von der Normalität des saturierten Bildungsbürgertums, das – so die These in Florian Pochlatkos How to be Normal – krankhafte Normverletzungen überhaupt erst hervorbringt.

“In einer Welt der unbegrenzten Möglichkeiten habe ich mich dafür entschieden, krank zu sein”. So Pia (Luisa-Céline Gaffron) über sich selbst in Florian Pochlatkos How to be Normal. Die junge Frau mit der unbändigen blonden Lockenmähne beschäftigt sich viel mit sich selbst. Zum Beispiel steht sie oft vor dem Spiegel. Kann man damit das erreichen, was der Filmtitel verspricht, nämlich Normalität? Vermutlich eher nicht, denn Normalität ist per Definition gesellschaftsrelativ, wenn überhaupt, ist sie also draußen in der Welt vorzufinden. Aus dem Spiegel hingegen schaut man immer nur selbst heraus. Die Norm verwandelt sich in ein abstraktes Ideal, im Vergleich zu dem man sich selbst nur noch als Abweichung wahrnehmen kann.
Außerdem schluckt Pia jede Menge Tabletten. Welche davon gesund machen und welche krank und welche high, welche Akne hervorrufen und welche Akne unterdrücken: darüber hat sie längst den Überblick verloren. Den Ärzten, denen sie im Film über den Weg läuft, fällt jedenfalls wenig mehr ein, als sie “mal auf etwas anderes einzustellen”. Probeweise, vielleicht hilft’s. Das Normale ist ein ewiges Provisorium. Und auch: ein ewiges Purgatorium.
Missratene Tochter in innerfamiliärer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme: Ewiges Purgatorium

Nicht nur für Pia, sondern auch für ihre Eltern. Wir befinden uns im saturierten österreichischen Bildungsbürgertum. Pias Mutter Elfie ist beim Fernsehen und spricht alberne Off-Kommentare für reißerische, tatsächlich ziemlich unterhaltsam ausschauende Tierdokumentationen ein. Ihr Vater Klaus wiederum arbeitet in leitender Funktion in einer Druckerei − die Digitalisierung steht vor der Tür und droht, das Geschäftsmodell auszuhebeln. Momentan kommt noch genug Kohle rein; selbst die missratene Tochter Pia kann, weil sie ansonsten nichts mit sich anzufangen weiß, im Geschäft untergebracht werden. Eine innerfamiliäre Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, Aufstiegsmöglichkeiten inklusive.
Oft, vielleicht allzu oft erzählt das deutschsprachige Kino Familiengeschichten in diesem Milieu. erzählt also von Leuten, die sich, so mag manch einer denken, die Probleme, die sie nicht haben, selbst erschaffen. Aber so einfach ist es natürlich auch wieder nicht. Frédéric Hambaleks Was Marielle weiß zum Beispiel, ein weiterer Mutter-Vater-Tochter-Film zwischen geräumigem urbanem Eigenheim und corporate jobs, zeigt derzeit, wie man, die richtigen szenischen Einfälle vorausgesetzt, einer solchen Konstellation unverbrauchte Pointen abringen kann.
How to Be Normal hingegen gelingt dasselbe eher nicht. Die wachsende Erkenntnis des Vaters, auf der Arbeit zum alten Eisen zu gehören; die − selbstmedikamentierte − Depression, in die die Mutter vor lauter Unterforderung in einer alle journalistischen Ambitionen an Clickbaits verratende Medienbranche rutscht: das alles bleiben Behauptungen, die allzu genau zu der dem Film offensichtlich zugrundeliegenden These passen, dass es eine kranke Gesellschaft ist, die den Einzelnen krank macht.
Eskalierendes Biertrinken am Würstlstand

Mehr Drive hat der Film, wenn er sich der Subjektivität Pias verschreibt und sich mit ihr, zum Beispiel, ins Wiener Nachtleben stürzt. Eskalierendes Biertrinken am Würstlstand. Auf dem Oberkörper des Typen, den sie auf einer Party aufreißt, blühen bunte Blumen. Auch die helfen ihr freilich nicht dabei, über ihren Exfreund hinweg zu kommen. Sie wird zur veritablen Stalkerin und dass ihr Ex, wie alle anderen Figuren des Films, ihren Grenzüberschreitungen mit reichlich Verständnis begegnet, hilft ihr auch nicht weiter. Vielleicht im Gegenteil. Wenn um sie herum alle spitzen Gegenstände versteckt werden, betrachtet Pia das als Herausforderung für kreativere Methoden der Selbstverletzung.
Flashframes und buchstäblichete Filmrisse übertragen den zerrütteten Geisteszustand der Hauptfigur ins Audiovisuelle. Pochlatko ist nicht daran interessiert, ein kohärentes Krankheitsbild zu entwerfen. Vielmehr bereitet er Pia immer wieder kleine Bühnen, auf denen sie ihre fundamentale Unangepasstheit zur Welt um sie herum performt. Regelrecht rampensaumäßig gelingt ihr das zum Beispiel vor der Glasfront einer Kneipe, in der die Gäste gleich die Smartphones zücken, um den Nervenzusammenbruch im öffentlichen Raum im Bewegtbild festzuhalten. Figuriert sich der Film in dieser Szene selbst? Voyeuristisch fühlt sich How to Be Normal zwar nicht an; aber dem Terror der Normalität hat auch Pochlatko nicht viel mehr entgegen zu setzen als die bloßen Schauwerte der Normverletzung.
Neue Kritiken

Ella McCay

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice

Ungeduld des Herzens
Trailer zu „How to Be Normal “

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.