Hillbilly Elegy – Kritik
Neu auf Netflix: Kurz nach Trumps Abwahl erscheint die Verfilmung eines Buches, das als Schlüssel zum Mindset seiner Wähler galt. Ron Howard träumt in Hillbilly Elegy aber ganz unverdrossen den American Dream.

Die deklassierten weißen Arbeiter in den USA, seit 2016 in aller Munde, sind doch selbst schuld, dass sie nicht rauskommen aus der Misere. Mit dieser Meinung hält der Aufsteiger J.D. Vance in seiner Erfolgsautobiografie Hillbilly Elegy nicht hinterm Berg. Zugleich liefert sein Bericht selbst genug Material, um ihm zu widersprechen. Denn sein Herkunftsmilieu ist darin so genau beobachtet, dass die sozioökonomischen Gründe für dessen Niedergang zwar nicht analytisch durchdrungen werden wie in Didier Eribons oft als Vergleich herangezogener Rückkehr nach Reims, aber eben in den Schilderungen unübersehbar aufscheinen. Und auch wenn man die Überzeugung vieler Rezensenten, die das Buch lasen wie einen Bericht von einem anderen Stern, nicht teilen muss, hier den definitiven Schlüssel zum Mindset der Trump-Wähler vorliegen zu haben: Ein aufschlussreiches Stück amerikanischer Sozialgeschichte ist Vance’ Buch allemal – zumal für europäische Leser, die eher stereotype Vorstellungen von „der weißen US-Arbeiterklasse“ haben und beispielsweise von den Unterschieden zwischen den Kentucky-Hillbillys und dem Ohio-Stahlarbeitermilieu nur wenig wissen dürften.
Destruktive Traditionen

Der Kontrast zwischen diesen beiden Welten bildet eine Grundspannung des Buches. Vance’ Großeltern verschlug es wie viele Leute aus den Appalachen auf der Suche nach Arbeit in die nördlicheren Industriegebiete. Im Ort mit dem programmatischen Namen Middletown kommen sie zunächst zu bescheidenem Wohlstand, ohne aber Habitus und Traditionen ihrer Heimat je abzulegen, die der Autor als durch und durch destruktiv beschreibt: clanartige Familienbande mit zweifelhaften Ehr- und Loyalitätsvorstellungen, Jähzorn, Gewalt, Alkoholismus. Vance verzweifelt in dem Buch förmlich an seiner Community, die nach dem Abstieg der Region zum Rust Belt und in die Massenarbeitslosigkeit störrisch in ihren obsoleten Verhaltensmustern verharrt. So streitbar das sein mag, sucht er die Hauptschuld an der Misere immerhin eher in spezifischen Eigenschaften eines Milieus – über deren Hintergründe man mit ihm nicht übereinstimmen muss – als in individuellen Verfehlungen. Letzteres besorgt nun Ron Howards Verfilmung von Hillbilly Elegy, die kurz nach Trumps Abwahl auf Netflix erschien.
Die Bürden des Hinterwäldlertums

Dass Drehbuchautorin Vanessa Taylor den umfangreichen Stoff des Buches auf zwei Tage Rahmenhandlung konzentriert, geht als dramaturgische Verdichtung durchaus auf. Zu Beginn des Films hat sich J.D. (Gabriel Basso) bereits zum Jurastudium nach Yale hochgekämpft. Bei einer generischen Culture-Clash-im-Restaurant-Sequenz bringen ihn die Bürden des Hinterwäldlertums bei Weinauswahl und Besteckgebrauch ins Schwitzen, als ihn der Notruf seiner Schwester Lindsay (Haley Bennett) erreicht: Seine Mutter liegt mit einer Heroinüberdosis im Krankenhaus. J.D. eilt mit dem Auto nach Hause, und während die Rahmenhandlung auf den Fluchtpunkt zuläuft, ob er es rechtzeitig zu einem zukunftsentscheidenden Bewerbungsgespräch zurück nach Yale schafft oder ihn Middletown in den Fängen behält – der Tunnel vorm Ortseingang wird mehrmals wie ein Nadelöhr zwischen den Welten ins Bild gesetzt –, wird in Rückblenden J.D.s und Lindsays Kindheit aufgerollt.
Dabei legt der Film seinen sehr engen Fokus auf die Geschichte einer kaputten Kleinfamilie. Den Herkunftskomplex und Kentucky-Ohio-Kontrast blendet er zwar nicht gänzlich aus: Gleich im einleitenden Voice-over berichtet J.D. von den Wurzeln der Seinen, eine kurze Anfangssequenz zeigt einen Kindheitsbesuch im Heimatort der Großeltern, der in eine Generationen zurückreichende Abfolge von Familienfotos mündet. Doch bleiben die nicht abzuschüttelnden Hillbilly-Eigenheiten im Film dann vor allem sicht- und hörbares Ornament – der Dialekt, die eigentümlichen Bezeichnungen „Mamaw“ und „Papaw“ für die Großeltern, die Oster- und Beerdigungsbräuche, der eine skurril, der andere würdevoll. Und ein Hauch Sozialkritik scheint auf, als die nicht versicherte Bev aus dem Krankenhaus geworfen wird. Im Wesentlichen aber gestaltet sich Hillbilly Elegy auf beiden Zeitebenen als eine Abfolge von Szenen, in denen sich Figuren entscheiden müssen, ob sie verantwortungslos oder verantwortungsvoll handeln, den schweren oder den leichten Weg einschlagen wollen.

Besonders schlecht kommt dabei J.D.s (von Amy Adams unter Dauerstrom gespielte) Mutter Bev weg. Obwohl einst Klassenbeste in der Highschool, verbaut sie sich notorisch jede Chance, kann keinen Job und keinen Partner halten und tyrannisiert herumschreiend und manchmal auch -schlagend ihre Kinder. Auch wenn einer kurze, gnädige Rückblende in ihre eigene Kindheit kurz erhellt, dass sie’s selbst auch nicht leicht hatte, legt Hillbilly Elegy bei Howard vor allem nahe, dass sie eben eine charakterschwache Person ist. Als J.D.s Rettungsanker und strenge Mentorin fungiert dagegen Großmutter „Mamaw“ (Glenn Close), stets mit Fluppe im Mund, selbst vom ruinösen Lebenswandel gezeichnet, aber weitblickend, was die Konsequenzen von Entscheidungen betrifft – einen Taschenrechner zu klauen, mit den Schmuddelkindern zu spielen.
Dass Close und Adams sich in ihrer Unterschichts-Kostümierung schauspielerisch gleichermaßen ins Zeug legen, wird vielfach als Oscar-Schaulaufen kritisiert, war aber bei den Eckdaten dieser Produktion von vornherein zu erwarten und müsste an sich nichts Schlechtes sein. So, wie sie hier als Repräsentantinnen der Working Class kontrastiert werden, hat aber insbesondere die Zeichnung von Adams’ Figur durchaus etwas Denunziatorisches. Der Film, der sie als eine zeigt, die, da seht ihr’s, andere im Stich lässt, lässt sie selbst ziemlich im Stich.
Auf Rollerskates durchs Krankenhaus

Natürlich ist Ron Howard ein viel zu gutherziger Regisseur, um böse Absichten zu verfolgen, und zumindest in den So-ging-ihr-Leben-weiter-Inserts vorm Abspann meint er es auch mit dieser Figur noch gut. Leichter erträglich macht das den Film nicht, dem man entgegenkommt, wenn man ihn schlicht als hoffnungslos naive Feier des American Dream versteht – wer sich anstrengt, der, q.e.d. J.D., schafft es auch –, und dem Vance’ Vorlage, mit der man wenigstens streiten konnte, dafür lediglich Einkleidung ist. Vor politischen Implikationen drückt sich der Film komplett. Die für J.D.s Persönlichkeitsformung vermutlich nicht unwesentliche Zeit bei den Marines hakt Hillbilly Elegy etwa nur in einer Fußnote ab, der seit Kubrick ikonischen Rekruten-Haarschur.
Übrig bleiben ein paar unterhaltsame Szenen: Wenn etwa Bev aus einer Laune heraus auf Rollerskates durch Krankenhausflure düst (und darauf ihren Job als Pflegerin verliert), oder wenn der junge J.D. (Owen Asztalos) mit seinen Kiffer-Kumpels nachts in eine Fabrik einbricht und dort sinnlos Dinge zerdeppert, dann ist das mit genügend Energie inszeniert, um einen als Zuschauer, losgelöst von den Absichten des Films, vom Ausbruchsbegehren der Figuren einzunehmen. Mir zumindest waren diese Szenen wie ihnen ein Ventil.
Neue Kritiken

"Wuthering Heights" - Sturmhöhe

No Good Men

Die Reise von Charles Darwin

Der große Wagen
Trailer zu „Hillbilly Elegy“

Trailer ansehen (1)
Bilder



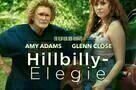
zur Galerie (10 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Peter Parlust
Der Film ist so simpel wie Ron Howard selbst , mitsamt seines stets vereinfachenden, verklärten Blicks (des Wegschauens) auf die USA. Andererseits ist dieser Film für Howard Verhältnisse schon wieder nahe am Arthouse , ok, Ironie Off !
Wenn es für mich überhaupt einen Grund geben könnte, dem Thema "Kulturelle Aneignung" mehr Beachtung zu schenken, dann aufgrund dieses Films. Ein misslungener, peinlicher Versuch, das "wahre" Leben von Clinton´s "Deployables" ausgerechnet vom Hollywood Mainstream Club in Szene zu setzen.

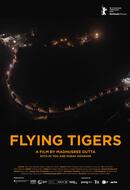















1 Kommentar