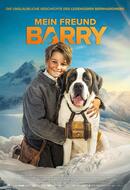Greta – Kritik
Totalitäre Mutterschaft: Der irische Regisseur Neil Jordan inszeniert in Greta den gewaltsamen Versuch einer Frau, sich das Leben einer anderen einzuverleiben.

„Greta“ heißt der Film, als kündige er ein Porträt an. Doch die komplette Vereinnahmung des Titels durch den Vornamen nimmt vorweg, was im Film auf uns zukommt: Es geht weniger um die Figur Greta als um ihren totalitären Anspruch; darum, wie sie ihre Tentakeln ausbreitet und in alle Bereiche eindringt, bis es nichts mehr gibt, was nicht auch das nach fremdem Leben lechzende Filmmonster Greta berührt hat, was nicht auch Greta weiß. Im Grunde inszeniert Greta den Kampf gegen die Einverleibung durch Greta; in der Hoffnung, es möge ein Raum bleiben, der vor der titelfüllenden Figur verschont bleibt.
Der Anschein von Normalität

Greta lebt in erster Linie von Isabelle Huppert, die in Greta einmal mehr eine verstörende Frauenfigur gefunden hat. Der Kopf, der etwas zu groß wirkt für diesen Körper, erinnert durchweg an den Kopf einer Puppe: Er hat ihre kindliche Ordentlichkeit, ihren in bemühtem Wohlwollen erstarrten Gesichtsausdruck, ihre unheimliche Künstlichkeit. Huppert versteht es, Grusel hervorzurufen; dieses Gefühl, das sich dadurch von der Angst unterscheidet, dass es in Situationen aufkommt, in denen wir nicht ganz sicher sind, ob wirklich eine Bedrohung besteht. Der Film siedelt Greta zunächst in genau diesem Bereich an, reizt Hupperts Fähigkeit aus, den Anschein der Normalität aufrechtzuerhalten und sie in jedem Augenblick unmerklich mit Unbehagen zu versetzen, bis alle Dämme brechen und das Unheimliche sich ungestört einen Weg bahnt.

Es beginnt mit einer herrenlosen Handtasche auf einem U-Bahn-Sitz, perfekt mittig platziert, als hätte sie selbst dort Platz genommen. Frances (Chloë Grace Moretz), die ehrliche Finderin, macht sich auf den Weg zur Besitzerin, Greta Hideg. Sie klopft an die Tür eines niedlichen Backsteingebäudes – hier ist sie, diese Niedlichkeit, die unversehens in Grusel kippen kann – und wird von Greta entzückt hereingebeten. Das Interieur strömt die etwas beklemmende Heimeligkeit dieser mit Krimskrams vollgestopften Räume aus, in denen spürbar ist, dass jedem Gegenstand eine besondere Aufmerksamkeit zuteilwird. Ein ganzes Leben ist da ausgestellt, und schnell wird deutlich, dass dieses Leben nicht mehr das ist, was es mal war. Eine mit Würde getragene Einsamkeit füllt das Haus. Frances, die selbst kürzlich ihre Mutter verloren hat, stürzt sich mit voller Kraft in diese Einsamkeit und findet in Greta eine Freundin.
Die Zeit brechen

Die Freundschaft findet ein jähes Ende, als Frances in Gretas Schrank zufällig eine Reihe von Handtaschen findet, die der von ihr gefundenen aufs Haar gleichen. Alle Handtaschen haben denselben Inhalt, an allen klebt ein Post-it mit – so lässt sich vermuten – dem Namen und der Telefonnummer der jeweiligen Finderin. Die gruselige Entdeckung nimmt nicht nur den weiteren Verlauf der Handlung vorweg, sondern streut auch ein essenzielles Motiv in den Film: die Abschaffung der Zeit als freier, vorwärtsgerichteter Bewegung und, an ihrer statt, die orchestrierte Wiederholung. Es genügt der Anblick der Handtaschen, um der idyllischen Annäherung zwischen Greta und Frances die Einmaligkeit abzusprechen und sie zur Abwandlung einer vorbestimmten Szene zu degradieren. Tatsächlich werden wir gegen Ende wieder einer Szene beiwohnen, in der eine ehrliche Finderin Greta eine Handtasche übergibt; überdeutlich ist diesmal der festgefahrene Plot.
Die Schwangerschaft wiederherstellen

Denn Greta ist hier die Regisseurin, sie schreibt die Geschichte, sie platziert die Requisiten, sie zieht die Strippen im Gewand des Zufalls und initiiert damit die Spannungskurve. Und sie castet: Offensichtlich hat sie nur an jungen Frauen Interesse. Dass Frances bald in einer Geschichte gefangen ist, in der Greta die Rollen zuweist, findet ein schönes Echo in einer der ersten Szenen, in der Frances mit ihrer Freundin Erica (Maika Monroe) in einem 3D-Kino ist. Wir sehen nicht den Film, sondern lediglich, wie er sich in Frances und Ericas Brillen spiegelt, buchstäblich und auf ihren Gesichtern, in dem Ausdruck, den er hinterlässt. Die Perspektive – die Kamera guckt von oben auf die Gesichter, die fast plattgedrückt wirken vom dem, was sie sehen – erzeugt ein Gefühl von Ausgeliefertsein, eine Hingabe zum Film. Gretas Plot wird Frances ähnlich überwältigen und einnehmen.

Es dauert nicht lange, bis sich dieser Plot abzeichnet, bis klar wird, welche Geschichte Greta da schreibt, und bis Frances merkt, was Greta vorhat. Das Stalking – zunächst unter dem Vorwand der Einsamkeit – nimmt immer krassere Züge an, kennt bald keine Grenze mehr. Greta versucht im wahrsten Sinne des Wortes, sich Frances einzuverleiben, sie symbolisch also in ihren Mutterleib zurückzubringen. Im Grunde stellt sie die Bedingungen einer extraterritorialen Schwangerschaft her: Sie strebt nach absolutem Gehorsam, absolutem Besitz, absoluter Formbarkeit, auf einem so klein wie möglich gehaltenen Raum, am besten direkt an ihrem Körper: Im Bett schmiegt sie sich an die erschöpfte, widerstandslose Frances. Am Ende wird das Monster sich selbst auffressen.
Neue Kritiken

No Bears

Scarlet

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother
Trailer zu „Greta“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (18 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.