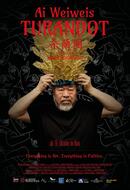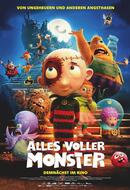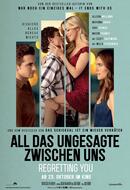Ginger & Rosa – Kritik
Sally Potter zeigt eine Jugend in London zwischen Kleinbürgertum und Kuba-Krise als zerrissene Momentaufnahme.

Ein Brückenschlag zwischen Welttragödie und privatem Drama: Von der Explosion der Hiroshima-Bombe schneidet der Film in ein Londoner Krankenhaus, in dem sich Gingers und Rosas in den Wehen liegende Mütter die Hände reichen. Ein Schnitt auf die wartenden werdenden Väter im Flur, ein kurzer Zeitsprung vorwärts auf zwei schaukelnde kleine Mädchen, und beim nächsten Schnitt sind wir schon im Jahr 1962, in dem zwei 17-jährige Teenager (Elle Fanning und Alice Englert) im Schatten der Kuba-Krise gegen die drohende atomare Auslöschung der Menschheit protestieren, angespornt von Gingers Vater Roland (Alessandro Nivola), einem Pazifisten, der für seine Überzeugungen im Gefängnis saß. Das private Drama nimmt seinen Lauf, als Rosa und Roland eine Affäre beginnen.

Coming-of-Age meets Period Piece, könnte man nach dieser Beschreibung denken. Doch von Filmen wie An Education (2009), die sich dem Zuschauer als akkurates Zeitgemälde und psychologisch plausibler Entwicklungsroman anbieten, ist Sally Potters neuer Film Ginger & Rosa weit entfernt. Aus Zutaten, die zu einem großen Drama ebenso taugten wie zu einem moralischen Lehrstück, bereitet der gerade 85-minütige Film eine recht schroff fragmentierte Momentaufnahme. Und wo Adoleszenzgeschichten oft die Perspektive des erwachsenen Rückblicks einnehmen, ist Ginger & Rosa ganz Vergegenwärtigung einer Wahrnehmung. Der Film bebildert einen Zustand der Verunsicherung an der Welt, Zukunft ungewiss.
Anders als der Titel und die Anfangsszenen, die die Mädchen als Quasi-Zwillinge inszenieren, es andeuten, zeigt Ginger & Rosa keine dramaturgisch gleichberechtigten Protagonistinnen, sondern ist ganz auf die rothaarige Ginger konzentriert. Durch die Affäre mit Roland, mit dem sie sich schwärmerisch als Gleichgesinnte wähnt, geht Rosa ihrer Freundin wie dem Zuschauer als Verbündete verloren und wird zum Teil der Welt, die Ginger nicht mehr versteht.

Diese Welt scheint recht schwach bevölkert. Das London des Jahrs 1962 wird als soziale Realität nur flüchtig angedeutet – selbst ein für die Mädchen zentraler Schauplatz wie die Schule erhält nur ein paar Sekunden Spielzeit, auch die Figuren der Friedensaktivistentruppe bleiben schemenhaft. Der jazzlastige Soundtrack macht vor allem deutlich, dass wir noch in den wenig swingenden Prä-Beatles-Sixties sind, eine Popkultur nach heutigem Verständnis noch nicht existiert. Eine aufziehende Libertinage wird mit Gingers schwulen Patenonkeln, die mit einer Schriftstellerin (Annette Benning) zusammenleben, vage angedeutet, ihre Wohnung gerät zum Zufluchtsort für das Mädchen vor der scheiternden Ehe ihrer Eltern, eines linken Akademikers und einer als Hausfrau verkümmernden Malerin (Christina Hendricks), kleinbürgerliche Tristesse im kalten Krieg.
Für alles, was er über Ginger und Rosa zu erzählen hat – ihre sexuelle Neugierde (auch füreinander), ihr Hang zur Abschottung und Rebellion, ihre Sinnsuche –, scheint sich der Film mit jeweils einer exemplarischen Szene zu begnügen, einem Kirchenbesuch etwa, einem gemeinsamen Bad, einer Autofahrt mit zwei Jungs, einem Zigarettenanzünden im Hof, oder wie die eine der anderen mit dem Bügeleisen das Haar glättet. Orte wie die Bank an der Hauswand, der Hinterhof mit Wäscheleinen und immer wieder das Gasometer sind stilisierte Stimmungsbilder von Einsamkeit und Enge, Verlorenheit und Sehnsucht, mal tagtraumhaft überbeleuchtet wie die Bootsfahrt mit dem Vater, mal tief schattig wie die vollständig ins Unheimliche verschobene Demonstrationsszene.

Der Intensität der Bildgestaltung steht eine eigentümliche Kargheit der Sprache vor allem dann gegenüber, wenn es um das politische Thema des Films geht. Dass Gingers Äußerungen zum drohenden Atomkrieg stets ein wenig wie aus zweiter Hand wirken, mag zeitlos typisch für Jugendliche sein, die sich pathetisch der Verbesserung der Welt verschreiben und dabei schon vom eigenen Leben heillos überfordert sind. Doch dass dies kein nur pubertäres Phänomen ist, zeigt Gingers Vater. Die Äußerungen des Atheisten und Aufklärers, der die Jugend zu Selbstdenken und Eigenverantwortung auffordert, wirken umso aufgesetzter und blutleerer, je deutlicher seine Unfähigkeit wird, die emotionalen Verheerungen zu begreifen, die seine Liaison mit Rosa anrichtet.
Während die in Nachrichtenhäppchen servierte Kuba-Krise dem Höhepunkt zustrebt, enthüllt auch Ginger vor der in der Küche versammelten Familie die Affäre. Die Close-ups auf Gesichter lassen keine Übersicht zu, das Verhältnis der Eltern fängt ein Bild ein, das links das Gesicht der Mutter in Großaufnahme und rechts im verschwommenem Hintergrund den auf der Treppe kauernden Vater zeigt. Wie durch Gingers tapfer durchgehaltene Contenance schließlich die Gefühle brechen und sie zitternd an den Rand des Sprachverlusts treiben, ist von Elle Fanning meisterhaft gespielt.

Wenig später verlässt man den Kinosaal dennoch etwas mürrisch. Von der ätherischen Leichtigkeit und Musikalität, mit der frühere Potter-Filme wie Yes (2004) oder Orlando (1992) ihren Hang zur Thesenhaftigkeit inszenatorisch ausglichen, ist Ginger & Rosa weit entfernt. Es ist, als würde man 85 Minuten mit moralischem und dramatischem Ballast beladen, ohne am Ende recht zu wissen, wohin damit. Gleich einem Teenager ist der Film ein wenig verwachsen, wie aus Elementen bestehend, die weder ganz zusammengehen noch ein Gleichgewicht finden. Wenn man Tage später diesen Ballast noch immer mit sich herumschleppt, mag einem aber erst verblüfft aufgehen, wie nahe einem Gingers Gemütslage genau damit gebracht wurde.
Neue Kritiken

Animale

Miroirs No. 3

Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes

Kung Fu in Rome
Trailer zu „Ginger & Rosa“


Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (8 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.