Futur Drei – Kritik
VoD: Faraz Shariats Debütfilm wechselt radikal die Perspektive von der weißen Mehrheitsgesellschaft zu denen, die wissen, wie das ist, die eigene Realität nicht auf der Leinwand zu sehen. In Futur Drei nehmen sie sich jetzt einfach den Raum.

Bilder, die Erinnerungen gleichen, aber auch Visionen sein könnten, zu schnell vorbei, um sie zu verorten: ein Pferd im Fluss, Hände, die sich gegenseitig halten, kleine, flüchtige Küsse zwischen Liebenden und denen, die es werden wollen. Kurz vor dem Ende wagt dieser Film einen Rausch der Schnelligkeit und der Unschärfe, indem er voller Lust am Pathos die Zeiten zerfließen lässt. Futur Drei heißt er schließlich und trägt selbst ein Tempus im Namen, eine Zeitform, die es nicht gibt, die im Debütfilm von Faraz Shariat jedoch zur Metapher dafür wird, eigene (filmische) Realitäten zu entwerfen.
Die Rückeroberung des Coming-of-Age

Die Erzählungen in diesem Tempus finden bei Shariat nicht abseits einer weißen Mehrheitsgesellschaft statt, sondern inmitten von ihr. Aber Futur Drei wechselt die Perspektive, tauscht radikal Narrative und das Personal eines deutschen Spielfilms aus, vor wie hinter der Kamera, sodass ein Cameo von Jürgen Vogel (wenn er es nicht ohnehin getan hätte) stört. Neben Burhan Qurbanis Berlin Alexanderplatz (2020) und Visar Morinas Exil (2020) lässt sich der vom queeren Hildesheimer Filmkollektiv Jünglinge produzierte Streifen als weiterer Beitrag eines zeitgenössischen, postmigrantischen Kinos lesen, das 2020 medial so präsent war wie kaum zuvor. Während Exil Erfahrungen von Alltagsrassismus und die Verschiebungen der Wahrnehmung, die damit für Betroffene verbunden sind, mit den stilistischen Mitteln des Thrillers bearbeitete, aktualisierte Berlin Alexanderplatz Döblins Großstadt-Epos, indem Qurbani Geschichte abklopfte und umschrieb. Futur Drei ergänzt diese Reihe, indem er bewusst ein anderes Vorhaben ausruft. Die niedersächsische Provinz wird bei Shariat zum Schauplatz einer spaßig-melancholischen Rückeroberung des Coming-of-Age, wo Sailor Moon und Nena sich bei Sonnenuntergang die Hände reichen (Musik: Jakob Hüffell, Saye Skye, Jan Günther).

Im Zentrum der Erzählung steht Parvis (Benjamin Radjaipour), der von Party zu Party tingelt, wenn kein Grindr-Date ansteht. Die Eltern sind aus dem Iran nach Deutschland gekommen, Sohn Parvis gehört also zur sogenannten zweiten Generation. Sein Farsi ist ein bisschen eingeschlafen, und das Land, das Mutter und Vater als Heimat beschreiben, kennt er nicht. Er besitzt einen deutschen Pass, wird aber doch beim Knutschen ständig gefragt, woher er denn jetzt eigentlich komme. Das Porträt schwulen Lebens abseits der Metropole, mit dem Futur Drei beginnt, vergrößert sich, als der boy mit den blondierten Haaren Sozialstunden im Asylheim ableisten muss. Dort lernt er Banafshe (Banafshe Hourmazdi) kennen, die mit ihrem Bruder Amon (Eidin Jalali) hierher geflohen ist. Amon, der kaum spricht und für den sich Parvis mehr und mehr interessiert, hält ihn bei der ersten Begegnung für einen neuen Heimbewohner, dem er die Anfangsphase erleichtern will. Und während Kupplerin Banafshe schon die Ärmel hochkrempelt, wollen Privilegien und Differenzen erkundet, Gemeinsamkeiten gefunden werden, wenn sich die beiden Männer in ihren unterschiedlichen Lebenswelten annähern und kollidieren.
„Uns gehört die Welt“

Futur Drei ist Liebesgeschichte, Fiebertraum, Trauerspiel der Behörden, kulturwissenschaftliche Identitätsabhandlung und autobiografische Familienerzählung (die Eltern des Protagonisten werden von Shariats realen Eltern gespielt), Parabel der Freundschaft, Einsteiger*innenseminar, Traumabewältigung, Ankunft und Aufbruch, Fashionfilm, Musikvideo. An Letzteres erinnert der Film oft, wenn sich die Musik über die Bilder erhebt und die Kamera (Bildgestaltung: Simon Vu) in diesen Sequenzen für eine Aufhebung der (hetero-)normativen Ordnung von Zeit und Raum plädiert. In seiner collagierten, geremixten Form, mit der Futur Drei auftritt, ist er vor allem aber Lehrstück darin, wie sich über das Leben in Deutschland in der ersten und zweiten Generation erzählen lässt, wer hier wie über wen Filme machen kann. „Uns gehört die Welt“, ruft Banafshe einmal von einem Hügel. Ihre Stimme schallt über die leeren Felder einer german landscape, an den Bäumen im Harzer Umland vorbei in die Ohrmuscheln der Zuschauenden. Der Satz hallt nach, wird später erneut fallen und das Ende des Filmes markieren. Er wirkt wie ein neues, stürmend-drängendes „I’m the king of the world “, nur dass es jetzt nicht mehr Leonardo DiCaprio brüllt, der eh schon ziemlich machtvoll durch die Welt stapft, sondern Banafshe.

Aus dem Ich wird Wir, ein Plural, die Titanic verwandelt sich zum Hügel im Harz, von dem es sich auch gut Richtung Horizont starren lässt. Eine Überhöhung des Moments, nach dem Banafshe dann doch darauf zurückgeworfen wird, dass sie nur auf einem blöden Hügel stand. War alles ein bloßer Traum? Nö. Das „Uns gehört die Welt“ ist bleibende Geste einer im deutschen Kino viel zu raren Figur – und von den jungen Filmemachenden um Shariat, die ihre Erfahrungen in einem rassistischen, sexistischen und homophoben System künstlerisch verarbeiten, um sich selbst und Zuschauende zu ermächtigen, die wissen, wie das ist, eigene Realitäten nicht auf der Leinwand zu sehen und als Andere erzählt zu werden, die sich jetzt einfach den Raum nehmen, für den vor ihnen schon gekämpft wurde.
Impulse für die Filmvermittlung
Wer das „Wir“ sein könnte, um das es bei Banafshes Ruf geht? Ein Katalog, der zum Kinostart im letzten Jahr von Arpana Aischa Berndt und Raquel Kishori unter dem Titel I see you – Gedanken zum Film FUTUR DREI herausgegeben wurde, schlägt folgende Antwort vor:
„Wir erzählen unsere Geschichten. Wir sind all diejenigen, die sich darin wiederfinden, aber auch diejenigen, die noch ganz andere Geschichten zu erzählen haben. Wir werden gefragt, woher wir kommen. Wie lange wir schon hier sind. Unsere Geschichten und die unserer Eltern werden als solche von Migration erzählt. Inmitten von Formulierungen von ‚Integrationskomödie‘ und ‚Familiendrama‘ werden sie reduziert: zu Pointen multikultureller Versöhnung oder postmigrantischen Darstellungen einer bedrohten Heimat.“
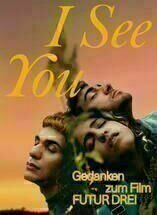
Der Katalog macht Futur Drei noch einmal mehr zu einem spannenden Projekt und unterstreicht, dass hier nicht nur über eine Veränderung der Narrative nachgedacht, sondern tatsächlich Wandel ausprobiert wird, auch in Sachen filmischer Produktion und Distribution, deren Prozesse der Katalog sichtbar macht. Unterschiedliche Beteiligte und Assoziierte des Filmes kommen zu Wort, ordnen ein, denken weiter. Besonders lesenswert ist beispielweise der Beitrag „Behind the Scenes“ von Arpana Aischa Berndt und Hoa Nguyen, die über die von ihnen organisierte Community-Arbeit mit den Laiendarsteller*innen nachdenken, die in den Dreh involviert waren. Und ein Mail-Gespräch über den Sound im Film („Knackendes Eis aka Kristall“) zwischen Musiker Jakob Hüffell und dem Musiksoziologen Johannes Salim Ismaiel-Wendt macht Lust, den Film gleich nochmal zu schauen, nein, lieber zu hören, so viel passiert dort vielleicht, was sich dem einmaligen Besuch des Filmes entzieht.
Der Katalog zu Futur Drei eröffnet ein weiterführendes Gesprächsangebot an die Zuschauenden und könnte wichtige Impulse für eine Filmvermittlung, die direkt von den Akteur*innen mitgeliefert wird, setzen. Darin wird reflektiert, warum genau Banafshe nicht das Glück findet, das das Kino für sie bereitzuhalten schien, worin die Probleme bestehen, die im (filmischen) Coming-out liegen (und das Futur Drei genau deswegen nicht macht); wo die Erinnerungen liegen, wenn die Bilder migrieren; warum dann doch im Film Fluchterfahrungen dargestellt werden, wenn sich dies dem Wissen der Teammitglieder entzieht. Der Band hält die Reibungen und Vielstimmigkeit aus, die auch der Film in sich trägt, und bündelt sie. Ein Katalog, der den Blick zurückwirft, auf das, was mal war, und auf mich als Zuschauerin im Hier und Jetzt, um sich dann nach unserer Begegnung weiter zu bewegen.
Der Film steht bis 16.07.2022 in der ARD-Mediathek.
Disclaimer: Die Autorin studiert an der Uni Hildesheim, an der auch der Film entstanden ist.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Futur Drei“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (17 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.








