Eine größere Welt – Kritik
Touristische Bedürfnisse: In Fabienne Berthauds Film Eine größere Welt lindert Schamanismus den Schmerz einer europäischen Frau.

Fast könnte man meinen, Eine größere Welt sei in einer anderen Welt entstanden. Eine Welt, in der es keine lange Tradition des fantasierenden, herablassenden oder exotisierenden Blickes auf das „Fremde“ gibt; eine Welt, in der sich eine Kamera noch folgenlos auf Menschen richten lässt, die selbst weder Bilder produzieren noch konsumieren; eine Welt, in der die auf sie gelenkte Aufmerksamkeit nicht das Risiko birgt, ihre Lebensweise nachhaltig zu verändern; eine Welt, in der es nicht weiter von Bedeutung ist, dass eine belgische Schauspielerin eine Toningenieurin spielt, während die Mongolen „sich selbst“ spielen; eine Welt, in der die Richtung, in die neugierig geguckt, in die gereist wird, zufällig ist und deshalb keiner Reflexion bedarf. Kurz: eine Welt, in der es eigentlich egal ist, wie man eine aus Sicht der Hauptfigur fremde Kultur darstellt.
Show für Touristen

Aber Eine größere Welt (Un monde plus grand) ist in unserer Welt entstanden, und das zeigt sich in der interessantesten Szene des Films, als zwei Touristen plötzlich in der Siedlung der nomadischen Tsaatan aufkreuzen. Wie auf Knopfdruck zieht sich Oyun (Tserendarizav Dashnyam, die einzige professionelle Schauspielerin unter den mongolischen Darstellern) die Schamanentracht über und tut das, was ein Laie für Schamanismus halten kann. Tatsächlich aber, so erklärt es Narantsetseg (Narantsetseg Dash) der schon länger anwesenden Corine (Cécile de France), rezitiert Oyun nur Kochrezepte. Vergnügt drückt das nach authentischen Erlebnissen gierende Touristenpaar den Mongolen Geldscheine in die Hände, ein gutes Geschäft für beide Parteien. Die Szene ist bezeichnend, weil man annehmen muss, dass Regisseurin Fabienne Berthaud sich darüber Gedanken gemacht hat, wie sie Corines Zugang zum Schamanismus darstellt, wie sie ihn abgrenzt vom offensichtlich für weniger legitim erachteten Interesse der Touristen. Als Zuschauerin fühlt man sich aber wie diese: vor einer auf touristische Bedürfnisse zugeschnittenen Show.

Eine größere Welt erzählt die Geschichte einer jungen Witwe, Corine, die von ihrem Arbeitgeber zu einer Schamanin in die Mongolei geschickt wird. Dort soll sie Tonaufnahmen machen für eine Dokureihe über Spiritualität („Geräuschkulissen, Gebete, religiöse Gesänge, lokale Musik“, lautet der unspezifische Auftrag). Während einer Zeremonie gerät sie selbst in Trance. Oyun, die Schamanin, erklärt Corine, dass auch sie Schamanin sei und lernen müsse, ihre Kräfte zu nutzen. Corine lässt sich darauf ein, weil sie darin eine Chance sieht, in Trance Kontakt zu ihrem verstorbenen Mann aufzunehmen. Ein Interesse für die Praktiken der Tsaatan über das für ihre eigene Trance nötige Wissen hinaus gibt es in diesem Film nicht. Eine größere Welt geriert sich dokumentarisch, besonders aufgrund der Tatsache, dass bis auf die Schamanin alle Tsaatan-Angehörige sich selbst spielen, dokumentiert aber vor allem, wie sich eine Frau aus Europa in der Tsaatan-Kultur das rauspickt, wovon sie sich Linderung erhofft.
Wissenschaftliche Validierung

Bisweilen lästig ist die Hartnäckigkeit, mit der Berthaud dem Publikum weismachen möchte, dass Schamanismus in den Neurowissenschaften erforscht wird. Zweimal schickt der Plot Corine ins Universitätsklinikum; erst um uns zu versichern, dass ihr Gehirn gesund ist, dann, um zu belegen, dass sich darin, wenn sie in Trance ist, etwas Nachmessbares abspielt. Dieses narrative Bestreben, die spirituellen Praktiken der Tsaatan durch eine wissenschaftliche Prüfung zu validieren, ist geradezu ärgerlich – und ein wenig elegantes Mittel, um Corines Empfinden glaubhaft zu machen.

Denn dass wir nicht an der Wahrhaftigkeit dieses Empfindens zweifeln, scheint dem Film ein zentrales Anliegen. So lässt sich auch die Regieentscheidung erklären, die Trance aus der Innenperspektive zu bebildern. Berthauds Darstellung fügt sich mühelos in gängige Repräsentationen bewusstseinsverändernder Zustände: Schnell und wirr wechseln sich Bilder und Geräusche ab bzw. überlagern sich, Schatten, Unschärfen und Verzerrungen bringen reale Abbildungen fast bis an die Unkenntlichkeit. Bedient wird sich dabei hauptsächlich in der Geräusche- und Bilderwelt der Tsaatan – schamanische Trommeln, Eulen, Wölfe, die Hufe der Rentiere auf der Erde –, nur der Farbe wird eine Absage erteilt. Auch die Textur spielt eine wichtige Rolle, die Darstellung hat etwas Raues, Hartes.

Die Rituale der Tsaatan werden ähnlich dargestellt. Berthaud setzt auf Reizüberflutung. Nahaufnahmen, etwa der tanzenden Oyun, verweigern uns den Gesamtüberblick. Bewegungen und Körperteile sind schwer zuzuordnen; es sollen Verwirrung und Desorientierung entstehen. Die Szene wiederum, in der Corine allein im Wald ist und an Ästen geknotete Tücher entdeckt, untermalt von unheilvollem Holzknacken, scheint schnurstracks aus einem Horrorfilm zu kommen. Dann schließlich gibt es märchenhafte Einstellungen, mit satten Farben, hüpfenden Baby-Rentieren und einer gut gesinnten Natur. Eine größere Welt schafft es also immer, die Tsaatan auf Distanz zu halten, die Fremde fremd sein lassen. Das macht die Welt wahrlich nicht größer.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Eine größere Welt“
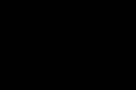
Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (10 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.












