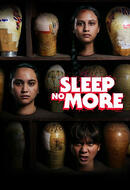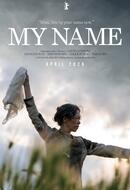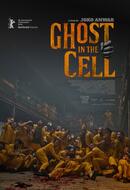Earwig – Kritik
Neu auf MUBI: Lucile Hadzihalilovic taucht eine karge Wohnung in ein dunstiges Zwielicht. Die Geschichte um einen Mann, ein Kind und ein tägliches Zahnspangen-Ritual ist auch nicht durchsichtiger. Sie spielt wahrscheinlich nach dem Zweiten Weltkrieg – falls sie überhaupt in einer realen Welt stattfindet.

Durch den Spalt unter der Tür fällt Licht in ein dunkles Zimmer. Der Boden hinter der Öffnung ist weitflächig in gleisende Helligkeit getaucht. Hinzu kommt ein feiner Luftzug, der den Staub und die kleinen Wollmäuse entrückt und grell strahlend tanzen lässt. Mit aller elterlicher Autorität löscht Albert Scellinc (Paul Hilton) aber das Licht im Flur, und das Kinderzimmer Mias (Romane Hemelaers) wird auf die Dunkelheit zurückgeworfen. Die in Earwig einmalige Vorherrschaft des Lichts endet jäh. Der Zauber des kurzen Moments ist vorbei.
Keine Hoffnung auf Außenwelt

Ansonsten ist Lucile Hadzihalilovics Film in ein allumfassendes Zwielicht getaucht. Kleine, schwache Lampen, die punktuell in den Räumen der Handlung zu finden sind, entreißen der Düsternis kaum mehr als Konturen und Ansätze von Farben. In den Zimmern ist es zudem noch dunstig. Etwas klar zu sehen, ist ein Privileg, das uns schlicht nicht gegönnt wird. Und der Film verlässt diese trüben Räume erst nach geraumer Zeit. Die Hoffnung, das Zwielicht in Richtung Außenwelt, die bisher weitestgehend hinter schweren hölzernen Jalousien versteckt wurde, zu verlassen, wird aber umgehend bitter enttäuscht. Draußen herrscht Nebel. Und wenn es nicht dieser ist, der alles einhüllt, dann ist es die Nacht. Schatten und Dunst, es gibt kein Entkommen.

Die damit erzählte Geschichte ist auch nicht durchsichtiger. Sie spielt wahrscheinlich nach dem Zweiten Weltkrieg – falls sie überhaupt in einer realen Welt stattfindet. Albert und das/sein Kind Mia wohnen zusammen in einer kargen Wohnung, in der er das Mädchen für die von ihm sogenannten „Master“ betreut. Das Leben der beiden besteht aus dem regelmäßigen Austauschen ihrer Spange gegen Zähne aus Eis – jedenfalls, bis sie neue aus Glas bekommt – und dem Bestaunen von rot eingefärbten, edlen Gläsern aus einer Vitrine. Öde und repetitive Abläufe bestimmen das Zusammenleben. Bis Albert Mia für ein Leben außerhalb der Wohnung vorbereiten soll.
Rätselhaft bis zum Ende

Gleich zu Beginn gibt es die klar getimten, aber eher unerklärlichen Abläufe eines dieser Spangen-Zähne-Wechsel zu bestaunen. Für die Figuren haben die Vorgänge einen klaren Sinn. Dieser erschließt sich aber nicht. Es fühlt sich vielmehr wie ein retrofuturistischer (Alp-)Traum an. Die Zähne wirken wie irrsinniger Hightech. Im Gegensatz zu den Ledergurten, mit denen die Spange angebracht wird, oder den mit Flüssigkeit gefüllten Glaskugeln an deren Seiten. All das ist bis zum Ende rätselhaft. Statt in einer festen Welt verankert zu sein, verbleibt alles auf einer vagen, assoziativen Stufe.

Dergestalt ist Earwig auch mit Zeitverschiebungen und Dopplungen versehen. So (tag-)träumt Albert mehrmals von Maria (Anastasia Robin), die womöglich die Mutter von Mia ist, während sich ein Nebenplot über die Kellnerin Céleste (Romola Garai) einzuweben beginnt, der Albert in einem Streit aus Versehen das Gesicht verstümmelt. Letztere zeigt sich daraufhin von Albert angezogen, in sexueller Hinsicht, aber auch aus Rachedurst. Aber nicht als erzählerische Koordinaten der Geschichte, sondern per Parallelmontagen finden die durch die drei Frauen symbolisierten Ebenen der Wohnung, der Erinnerung und der Außenwelt zusammen. Und so wirken sie wie Surrogate voneinander, die auf unterschiedlichen Traum- und Realitätsebenen aufeinander abstrahlen oder füreinander einstehen.
Angstschweiß des Träumenden

Earwig ist ein Horrorfilm. Aber nur an zwei Stellen schlägt die Spannung in drastische Gewalt um und gönnt dem Zuschauer etwas Katharsis. Ansonsten herrscht eine klamme, unbestimmte Klaustrophobie, in der alles beunruhigend wirkt und erscheint, ohne dass die Bedrohung klar auszumachen wäre. Motive bestimmen den Film. Motive wie das gespenstische Klappern der gespenstischen Zähne Mias, die gegen die Wand ihres Zimmers lehnt, während Albert auf der anderen Seite ein Wasserglas zwischen Ohr und Wand hält, um zu hören. Vielleicht lässt sich der Dunst in der Wohnung auf den Angstschweiß des Träumenden zurückführen, der bald erwachen wird.

Im Mittelpunkt steht eine opake, surreale Welt, in die bedrohlich wirkende Ärzte, diabolische Saufkumpane oder, in Form einer verständnislosen Putzfrau, die Ahnung eindringen, dass all dies nur eine Wahnvorstellung ist. Viel lässt sich in dieses erzählerische Zwielicht hineinlesen. Vom Leben in einer repressiven Gesellschaft oder in/nach einer Krise wird erzählt. Von Reue, Verlorenheit, Orientierungslosigkeit, Ausgeliefertsein. Von Eltern, die durch die Verantwortung für ein Kind ihren Halt in der Welt verlieren. Seine Stärke findet Earwig aber nicht in dieser interpretatorischen Offenheit, sondern in seiner Gestaltung. Die Lichtsetzung und die Kamera (Jonathan Ricquebourg) lassen bei allem Zwielicht eben keinen Matsch entstehen, sondern setzen Gesichter und Räume atmosphärisch in Szene. Die Bilder kriechen einem kalt den Rücken hoch. Die sphärische Ondes Martenot-Musik von Augustin Viard bietet keine Auswege, sondern ist ein ebenso schönes wie zwielichtiges, einhüllendes Tuch.
Prestige statt Rhythmus

So sehr die Bilder aber eine introspektive, verschlossene Qualität haben, so wirken sie mit der Zeit doch selbstverliebt und aufdringlich. Als affektives Kino ist Earwig – gerade bei zwei Stunden Laufzeit – zu willkürlich und verliert sich in seinem Kleinklein. Vor allem da die Motive, an denen er sich entlangschwingt, so gleichartig sind, dass sie sich zunehmend abnutzen. Andererseits ist der Rhythmus des Films nicht zwanghaft und besessen genug. Er fließt mal hier-, mal dahin, und ist doch schließlich auf einen klaren Endpunkt ausgerichtet. Womit Earwig auch nicht als hypnotische Erfahrung funktionieren will. Es bleibt bei einem Film, der ziemlich schön ist, nur lässt sich das Gefühl nicht abschütteln, dass es Hadzihalilovic mehr darum geht, ihr Prestige als Künstlerin darzustellen. Den Film selbst lässt sie in dieser Eitelkeit etwas teilnahmslos zwischen den Stühlen stehen und gibt sich mit weniger zufrieden, als den vorhandenen Qualitäten guttut.
Den Film kann man bei MUBI streamen.
Neue Kritiken

Ella McCay

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice

Ungeduld des Herzens
Trailer zu „Earwig“


Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (10 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.