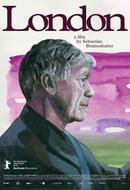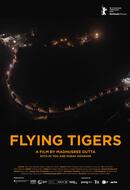Drive My Car – Kritik
VoD: „Was sollen wir tun? Wir müssen leben.“ In Drive My Car verwebt Ryūsuke Hamaguchi die Lakonie Murakamis mit der Melancholie Tschechows und untersucht behutsam die Spuren, die Menschen in den Leben anderer hinterlassen.

Im dämmrigen Licht geht der Blick aus dem Fenster eines Apartments auf Tokyo. Davor erhebt sich bedächtig die dunkle Silhouette einer Frau, die beginnt, eine Geschichte zu erzählen: Ein Mädchen dringt dort heimlich in das Zimmer des Jungen ein, den sie liebt. Sie entwendet Dinge, andere lässt sie zurück, als Zeichen, dass sie dort gewesen ist. Diese Erzählung, vorgetragen von Oto (Reika Kirishima), der Frau des Protagonisten von Drive My Car, gibt bereits vor, was Ryūsuke Hamaguchi in seinem neuen Film auf ineinander verschlungenen Ebenen untersucht: die Spuren, die Menschen im Leben von anderen hinterlassen.
Dramatik ohne Pathos

Dabei folgt der Film einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami über den Schauspieler Kafuku (Hidetoshi Nishijima), der sich gegenüber seiner jungen Fahrerin langsam öffnet. Der Film ist eine Adaption im besten Sinne. Er nimmt sich Murakamis Vorlage an, variiert und erweitert sie. Drive My Car ist zugleich ein Gegenentwurf zu Hamaguchis ebenfalls 2021 erschienenem Film Wheel of Fortune and Fantasy. Der Vorgängerfilm war ein Triptychon aus Episoden, in denen der Filmemacher mit leichter Hand von schicksalshaften Verstrickungen erzählte. Bei Drive My Car wählt er den umgekehrten Weg und entwickelt aus einer erzählerischen Skizze einen epischen Film, der sich mit großer Ernsthaftigkeit in die Tiefenstrukturen von Verlust und Selbstbefragung gräbt.

In einer geschickten Neuanordnung entwickelt Hamaguchi aus dem, was Murakami in einer Rückblende erzählt, den Prolog seines Films. Darin erzählt er von der Beziehung zwischen Oto und Kafuku, die sich nach dem Tod der gemeinsamen Tochter zwischen schmerzhafter Vertrautheit und neuartiger Distanz bewegt. Die zufällig entdeckte Untreue Otos wird verschwiegen und durch ihren plötzlichen Tod auch unaussprechbar. Die Stärke des Films liegt darin, diese Ereignisse ohne Pathos zu erzählen, ihre Dramatik aber auch nicht herunterzuspielen. So wird der Prolog zur emotionalen Grundlage der späteren Handlung: zurückhaltende Melancholie.
Eine andere Art des Verstehens

Zwei Jahre nach der Tragödie erhält der Schauspieler das Angebot, am Theater in Hiroshima Onkel Wanja zu inszenieren. Und auch in Anton Tschechows Stück findet Hamaguchi eine Spiegelung dessen, was Kafuku geschieht: die Vergangenheit, die ihn einholt, die Menschen, denen er begegnet. Für diese Zeit wird ihm Misaki (Toko Miura) als Fahrerin zugeteilt, auf die er sich nur widerstrebend einlässt, weil sie ihn in einer Routine stört: Um sich in das Stück zu vertiefen, das er inszenieren soll, hört er auf den Fahrten zwischen Unterkunft und Theater alte Kassetten, auf denen Oto den Text eingesprochen hat.

Die Dialoge aus Onkel Wanja sollen dabei nicht übersetzen, was die Figuren im Inneren umtreibt. Sie bieten sich eher als Kommentar an, der Kafukus Auseinandersetzung mit dem Geschehenen durch Verschiebungen neue Seiten hinzufügt. In den Theaterproben wird das Stück in einer mehrsprachigen Version einstudiert, sodass die SchauspielerInnen sich untereinander nicht verstehen. Dabei zeigen sich zugleich die Grenzen dessen, was Sprache leisten kann, und der Ort, an dem eine andere Art des Verstehens beginnt. Auch Kafuku muss irgendwann begreifen, dass er Oto in seinen Versuchen, die Vergangenheit gedanklich zu durchdringen, nie ganz ergründen wird, und damit zu einem neuen Verständnis kommen.
Achtsame Vertiefung

Hamaguchi hat in Interviews davon gesprochen, wie wichtig das Zuhören für seinen Prozess des Filmemachens ist. Diese Erfahrung hat er in seinen Dokumentarfilmen mit den Überlebenden der Erdbebenkatastrophe im Osten Japans (Tohoku Documentary Trilogy, 2011–2013, zusammen mit Sakai Ko) und bei der Arbeit mit Schauspielstudierenden an seinem Film Intimacies (2013) gemacht. Das geduldige Einlassen auf den Anderen ist auch in Drive My Car präsent, im Austausch der Figuren, die einander den Raum zugestehen, sich zu öffnen und Geschichten zu erzählen; in der beobachtenden Haltung Kafukus, der seinen SchauspielerInnen vorsichtig einen wahrhaftigen Ausdruck entlockt. Der Protagonist wird dabei nicht Identifikationsfigur, dafür bleibt er zu entrückt. Stattdessen bietet der Film seinem Publikum eine Perspektive an, die ein Mit-Erleben ermöglicht, ohne von den Figuren vereinnahmt zu werden.

Die achtsame Vertiefung ist eine Form der sinnlichen Rezeption, die auch zur Ästhetik des Films passt. In klaren Bildflächen und bedächtigem Tempo vermittelt er einen Rhythmus der aufmerksamen Gegenwärtigkeit und erschafft einen Resonanzraum, in dem sich Emotionen langsam entfalten können. Die geschlossenen Räume des Theaters und Kafukus Auto sind dabei die Bühnen, auf denen Hamaguchi behutsam die Komplexität menschlicher Verhaltensweisen analysiert. Das klare, zurückgenommene Spiel der SchauspielerInnen ist dabei kein Hindernis, sondern lässt vielmehr zu, sich auf das einzulassen, was ihren Figuren widerfahren ist.
Zärtliche Akzeptanz

Die Vergangenheit ist in diesem Film überall, nicht nur in den individuellen Geschichten, die die Figuren langsam voreinander enthüllen, sondern auch an den Orten, die seine Handlung bestimmen. Wenn die schweigsame Misaki anfängt, von ihrer Vergangenheit zu sprechen, passiert das auf der Sichtachse, die die Denkmäler des Atombombenabwurfs im Jahr 1945 verbindet, und führt so das persönliche mit dem gesellschaftlichen Trauma zusammen. Schließlich ist es auch die Reise an den Ort eines zurückliegenden Unglücks, die einen Ausweg aus dem Leiden an den Erinnerungen verspricht.

Mit dieser Erzählung zärtlicher Akzeptanz hat Ryūsuke Hamaguchi einen so behutsamen wie klaren Film gedreht, vielleicht den schönsten des Jahres. Lediglich der Epilog, der die Handlung in der Gegenwart verortet, irritiert dann trotz der Bezüge zur Pandemie mit einem vielleicht zu optimistischen Ausblick. Prägnanter für den Geist von Drive My Car, in dem Hamaguchi meisterhaft die Lakonie Murakamis, Zen und Tschechows Melancholie zusammenbringt, sind die Worte des russischen Autors: „Was sollen wir tun? Wir müssen leben.“
Der Film steht bis 31.05.2024 in der Arte-Mediathek.
Neue Kritiken

Allegro Pastell

A Prayer for the Dying

Gelbe Briefe

"Wuthering Heights" - Sturmhöhe
Trailer zu „Drive My Car“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (17 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.