Die letzte Stadt – Kritik
Avantgardistischer kleiner Bruder zu Nolans Tenet: In Die letzte Stadt wirft Heinz Emigholz die Frage auf, ob es in einer global vernetzten Welt überhaupt noch möglich ist, an einem Ort zu sein, oder ob wir nicht immer zugleich hier und irgendwo anders sind.

Wer von Heinz Emigholz’ neuen, dialoghaltigen Filmen spricht, kommt nicht umhin, auch von der vorangegangenen, zwanzigjährigen Phase zu sprechen, in der der Filmemacher Sprache fast vollkommen aus seinem Repertoire ausschloss und sich auf die Darstellung architektonischer Strukturen konzentrierte. „Architekturdokumentationen“ nennen das manche Kritiker, doch unterschlägt dieser Begriff den Reichtum von Emigholz’ Ansatz, den er selbst als die „Konstruktion einer imaginären Architektur in der Zeit“ beschreibt. Emigholz bastelt seit vielen Jahren an einem utopischen Gegenentwurf zur Trostlosigkeit der gebauten Umwelt unserer Tage, indem er die Arbeit einer eklektizistischen Auswahl von Architekten porträtiert, die ihm besonders wichtig erscheinen. Dabei denkt er diese Gebäude aber ebenso mit dem Mitteln des Films weiter, wie er diese das filmische Medium umgestalten lässt.
Angespanntes Verhältnis zwischen Narration und Schauplatz
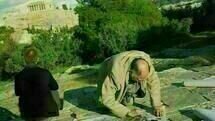
Überraschend war es im Kontext von Streetscapes [Dialogues] von 2017, Stimmen zu Emigholz’ „Rückkehr zum narrativen Kino“ zu hören. Nicht nur waren sein Architekturfilme zwar stumm, aber durchaus erzählend, [Dialogues] besitzt in vielerlei Hinsicht sogar ein schwierigeres Verhältnis zum Narrativen als diese. So ist in diesem Film der klare chronologische Faden gerissen, der uns bei Emigholz sonst durch gebaute Welten führt. Stattdessen erscheinen in den weiterhin nach architektonischen Gesichtspunkten gewählten Einstellungen die Figuren eines Psychoanalytikers und eines Filmemachers, und deren Therapiegespräch entfaltet sich nun als Kontrapunkt zur visuellen Ebene. Ein narrativer Film? Ja, aber nur in einem gebrochenen, ambivalenten Sinn, denn Schauplätze und Figuren ziehen hier aneinander vorbei und berühren sich nur punktuell.

Dieses angespannte Verhältnis von Narration und Schauplatz ist in Emigholz’ neustem Film Die letzte Stadt noch stärker ausgeprägt. Oberflächlich betrachtet, handelt es sich um einen Episodenfilm, der in fünf verschiedenen Städten auf verschiedenen Kontinenten spielt. Die erste Episode, angesiedelt in Be’er Sheva, handelt vom Psychoanalytiker aus dem vorherigen Film, der zum Waffendesigner wird, eine andere von einem inzestuösen Brüderpaar in Berlin, dessen Liebe absurderweise von Familie und Kirche Absolution erteilt wird. Obwohl jede Episode von einer Art Sitcom-Jingle der Band Kreidler eingeleitet wird und klassische Establishing Shots uns die jeweilige Stadt zeigen, kann kaum davon die Rede sein, dass die Episoden in einem herkömmlichen Sinn „in“ diesen Städten spielen. Nicht nur sind vier der fünf Episoden zeit- und ort-unspezifisch, auch setzt Emigholz hier die aus seinen Architekturfilmen bekannte Methode fort, in schneller Folge eine Vielzahl von Schauplätzen zu erkunden, wobei er es stets vermeidet, einen Aufnahmewinkel mehr als einmal zu verwenden.
Gedanken als lesbare Oberflächen

So zerstreut sich im Verlauf jeder Szene das Schema von Schuss/Gegenschuss, einer eigenen Logik folgend, über den ganzen Raum. Figuren, Dialoge und die komplexen Probleme, die darin entwickelt werden, scheinen eher nach metrischen Prinzipien in den Einstellungen platziert zu sein als nach inhaltlichen und legen sich so als zusätzliche Schicht über die architektonischen Strukturen, die die Bilder nach wie vor dominieren. In den Worten des Filmemachers: „Der Kameraregisseur tastet die Oberflächen einer monströsen Realität ab, um deren aktuelle Verpeiltheit darzustellen. Die Oberflächen des Wirklichen werden wie Gedanken umgedreht, und die Gedanken werden zu Oberflächen, die gelesen werden können.“ Auf diese Weise wirft der Film auch die Frage auf, ob es in einer global vernetzten Welt überhaupt noch möglich ist, an einem Ort zu sein, oder ob wir nicht immer zugleich hier und irgendwo anders sind.

Die Episoden in Die letzte Stadt weisen weder einen narrativen noch einen allegorischen Zusammenhang auf, der irgendwie auf der Hand läge. In einer Art Befragung der eigenen Intuition hat sich Emigholz auf Themen besonnen, die verschiedener nicht sein könnten, im Vertrauen darauf, dass diese gerade dadurch in der Summe ein annähernd zutreffendes Bild einer unendlich zerfaserten Gegenwart ergeben. Kleine Querverbindungen innerhalb der Themenblöcke erlauben es, die Episoden zu verknüpfen, erzwingen es aber nie. So trifft in der ersten Hälfte des Films ein älterer Herr in Athen auf sein jüngeres Ich, und gegen Ende wird in der Unterhaltung eines Kosmologen mit einer Kuratorin in Sao Paolo über die theoretische Möglichkeit einer solchen Begegnung spekuliert. Der Kosmologe selbst erweist sich als ein Alter Ego des Waffendesigners, und so scheint das a-chronologische Netzwerk dieses Films in verschiedenen Richtungen durchquerbar zu sein, ganz ähnlich Christopher Nolans Tenet (2020) [LINK], als dessen avantgardistischen kleinen Bruder man sich Die letzte Stadt vorstellen kann.

Die am Anfang und am Ende des Films erklingende Erzählerstimme deutet an, dass es sich bei der Handlung des Films um eine Abfolge von Träumen handelt. Diese bringen am Ende aber etwas Reales hervor. So wie die Überblendung der verschiedenen Themenblöcke eine sich ständig verflüchtigende Gegenwart kartiert, führt die Kombination der fünf Städte im Traum zur „letzten Stadt“, die alle anderen in sich enthält. Dazu Emigholz: „Aber ich denke, die letzte Stadt, als eine Idee, ist eine Kombination aus all dem: dass es eine Lösung gibt, oder so etwas wie eine Lösung. Der Mann, der im Voice-over spricht, weiß nicht, in welcher Stadt er ist, und in seinem Traum versucht er es herauszufinden. Es ist die Idee einer Lösung.“ (Cinemascope Magazine, Übersetzung des Autors)
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Die letzte Stadt“

Trailer ansehen (1)
Bilder

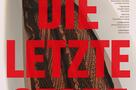


zur Galerie (13 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.






![Streetscapes [Dialogues]](https://www.critic.de/images/streetscapes-dialogue-teaser-23c07.jpg)
![Bickels [Socialism]](https://www.critic.de/images/bickels-socialism-3-17e56.jpg)



