Der vermessene Mensch – Kritik
Wessen Geschichte wird erzählt, wer kommt aufs Filmplakat? In Der vermessene Mensch widmet sich Lars Kraume deutschen Kolonialverbrechen in Namibia – und muss sich auf der Premiere kritische Fragen anhören.

Sie kommen, um zu messen: Die deutschen Kolonialherren in ihren weißen Westen verabreden sich zur Feldforschung anlässlich der Berliner Kolonialausstellung. Dabei sollen sich Nama und Herero einer Leibesvisite unterziehen, jeder Zentimeter wird mit kalten, schweren, scharfkantigen Metallinstrumenten ausgemessen. Der fahlhäutige, unbeholfene Student Alexander Hoffmann (Leonard Scheicher) untersucht Kunouje Kambazembi (Girley Charlene Jazama), die die Prozedur vor allem in der Hoffnung über sich ergehen lässt, mit ihrer politischen Delegation den Kaiser treffen zu können.
Professor von Waldstätten (Peter Simonischek), empathieloser Ethnologe, der in seiner rabiaten Gestalt auch die Messinstrumente grob auf die Menschen, die Objekte seiner Forschungsbegierde, zielen lässt, reißt die Haut an Kunoujes Schläfe auf. Der Blutstropfen, der dabei auf der Schläfe erscheint, ist nicht der Grund für die Tränen, die daneben hinunterrinnen. Vielmehr ist es das Gefühl, ganz und gar Objekt zu werden, und als dieses Objekt jegliche Form der Versehrung erdulden zu müssen. Der vermeintlich freundliche Student, schockverliebt in seinen Untersuchungsgegenstand, bittet als Abschluss zum Zähne-Zählen und deutet Gewalt in Intimität um. Das Unvermögen, eigenes Handeln und Fühlen zu reflektieren, gleich einem Bad in Naivität, wird zur Motivation für seine spätere Reise nach Namibia, bei der er Kunouje wiederfinden will.
Schale Unentschlossenheit

Nun ist diese Handlung von Lars Kraumes Der vermessene Mensch schnell erzählt, spannender ist die Frage, wie ein deutscher Regisseur, der vor einigen Jahren die Lust an gesellschaftlich relevanten Themen entdeckt hat, das historisch-politisch brisante Thema deutscher Täterschaft in Namibia in Szene setzt. Hat er filmische Ideen, die Teil einer Erinnerungskultur werden könnten? Welche Figuren entwickelt er, um Zuschauer·innen in Namibia und Deutschland zu erreichen?
In Der vermessene Mensch folgen wir durchweg dem weißen Protagonisten: erniedrigt von der Mutter, beim Kühlen seiner Wunden, vor den Leichen erschreckend, bei jedem Schuss zusammenzuckend, und auch, wenn er Schädel sägt und raubt. Sollen wir uns in diesem Protagonisten wiedererkennen, oder sollen wir ihn für sein Verhalten verachten? Die Unentschlossenheit des Films in dieser Frage ist nicht produktiv, sondern schal, weil Kraume sie nicht für eine bewusste dialektische Figur nutzt, sondern eher dafür, seinen Film unangreifbar zu machen. In diesem Absicherungsmodus wird der Täter auch mal Opfer, der Professor auch mal Kumpel, wird der verliebte Ethnologe auch mal gefühlig, und der brutale Offizier in der Wüste auch mal Vertragspartner. Dieser schlingernde Weg wird gestützt durch Bild- und Handlungs-Klischees: Sehnsucht heißt dann, das zerknitterte Foto von Kunouje hervorzuholen, und Reue wird als blutiges Steak aufgetischt. Die komplexen historischen Zusammenhänge werden durch diese platte Bildlichkeit und ein lineares Abhandeln von Taten stark vereinfacht.
Ins Notizbuch eingeklemmt

Die eingangs beschriebene Examinierung ist eine der brutalsten Szenen des Films. Die Kamera wiederholt ohne Brüche den kolonialen Blick. Soll diese simple Wiederholung darauf hinweisen, dass Kolonialverbrechen nicht geschönt werden dürfen? Demgegenüber stehen Publikumsstimmen wie jene am Abend der Premiere zum Kinostart. Jemand versteht nicht, warum er die Traumata seiner Familie auf der Leinwand wiederholt erfahren muss und bezieht sich vor allem auf Szenen aus dem Konzentrationslager Shark Island. Hier entscheidet sich Kraume nicht nur dafür, Schwarze Menschen angekettet vorzuführen, sondern diese müssen noch einmal für die Kamera die Schädel der Verstorbenen skalpieren.
Es scheint grotesk, aber vor allem einfallslos, dass solche Szenen 2023 entstehen, wenn sich viele Ethnologische Museen seit Jahren mit der Frage beschäftigen, wie man Schaukästen neu anordnet und bis in die Gegenwart bestehende Rassismen und koloniale Selbstverständlichkeiten bricht. Auch der Versuch, Kunouje auf Plakaten und in Vorankündigungen zur Hauptfigur zu erheben, irritiert, wenn man bedenkt, wie wenig Interesse Der vermessene Mensch ihr zukommen lässt, und dass die Erzählung sie über weite Strecken einfach vergisst. Als fotografisches Abbild, eingeklemmt ins Notizbuch von Hoffmann, wird sie zum Anschauungsmaterial. Kaum verwunderlich, dass eine Zuschauerin ein Gefühl des Unbehagens ausmacht, wiederholt doch der Film selbst einen Gestus, der Figuren jenseits der weißen Deutschen unsichtbar macht.
Kein Gemetzel?

Auf dem Podium erläutert Kraume seine Intention, „kein Gemetzel“ zeigen zu wollen. Möglich sei ihm dies durch die Figur des Ethnologen geworden, denn der sei „nicht dabei“, immer etwas abseits vom Kriegsgeschehen. Und weiter: In Deutschland würde man gern die Stimmen der Opfer hören, wenn man aber Geschichten aus der Opferperspektive erzähle, betreibe man kulturelle Aneignung. Einziger Ausweg sei demnach eine Erzählung aus Täterperspektive.
Das Problem liegt aber nun darin, dass der Film diese Perspektive nicht konsequent verfolgt. Platziert man Ethnolog·innen auf einem Nebenschauplatz der Geschehnisse, übersieht man, dass es das von Kraume in langen Einstellungen reinszenierte „Gemetzel“ der Ethnolog·innen war, das Rassentheorien entscheidend etablierte. Die unsichtbare Gewalt einer rassistischen Forschung, gehüllt in den Deckmantel der Objektivität, macht auch aktuelle Debatten um Restitution so wichtig: Die geraubten Schädel und Kunstgüter sind sichtbare Belege für die gewaltvollen Taten.
Vergebene Chancen

Auf dem Podium wurde Kraume auch gefragt, warum er Produktionsgelder nicht für die Unterstützung von Filmprojekten in Namibia umwidme. Er belächelt solche Gedankenspiele als unrealistisch: Sein Beruf sei es, Filme zu machen. Hier entpuppt sich das eigentliche Unvermögen: Der Regisseur hätte ein kollektives Projekt erarbeiten und somit Mehrstimmigkeit den Weg ebnen, hätte mindestens eine·n Regisseur·in aus Namibia in dieses Projekt künstlerisch involvieren können. Die deutsche Filmförderung hätte dabei zeigen können, dass Koproduktionen nicht nur wirtschaftliche Zwecke haben, sondern zur Vermittlung und Unterstützung einer transnationalen Filmsprache dienen. Dabei hätte deutlich werden können, dass schon der Prozess der Stoffentwicklung ein politischer ist.
Entlarvend hingegen, dass die Hauptdarstellerin Girley Charlene Jazama am selben Abend erwähnt, dass sie Kraume geraten habe, das Drehbuch umzuschreiben: Es dürfe keinen „white-savior-Moment“ geben, doch genau diesen habe die ursprüngliche Drehbuchfassung mit dem Täter als Retter noch verfolgt. Da ist es wieder, das Unbehagen: Die Verarbeitung der Täterschaft lässt sich nicht einfach umschreiben, wenn die eigene Haltung fehlt.
Neue Kritiken

Ella McCay

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice

Ungeduld des Herzens
Trailer zu „Der vermessene Mensch“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (15 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Tom Pisa
Bei aller guter Absicht, wenn ich mir allein den Vorfilm anschaue, stelle ich mir direkt einen Sesselfurzer Bioland-Potatoe-Chip Abend mit "Haltung" vor.
Das sieht alles aus wie ein schlechter Versuch mit Netflix konformer Ästhetik deutschen Kolonialismus aufzuarbeiten. Bei mir bleibt es also definitiv bei der Vorschau.
Lars Kraume möchte ich gerne zurufen "mach mal lieber Deinen 11. Tatort oder einen weitere Dengler Krimi". Dazu reicht es bestimmt.


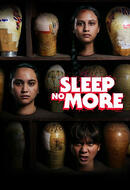
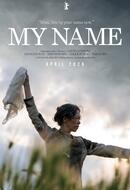

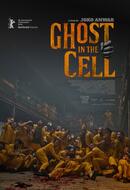











1 Kommentar