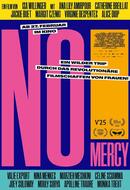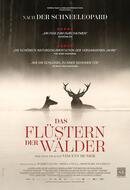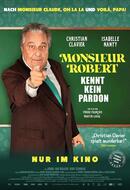Der Meister und Margarita – Kritik
Michael Lockshins Der Meister und Margarita fügt Versatzstücke aus der Romanvorlage zu einer wilden Liebes- und Rachegeschichte zusammen. Das Historien-Fantasy-Spektakel orientiert sich stilistisch am Blockbusterkino, entfesselt aber zugleich eine widerständige teuflische Kraft.

Moskau in den 1930er Jahren: Pendelnd gleitet die Kamera zu Atemgeräuschen einen langen Korridor entlang und nähert sich schließlich einem Fenster, durch das ein riesiger digitaler Vollmond scheint. Die Scheiben schwingen auf, der Kameraflug setzt sich im Freien um das hohe Gebäude fort und steuert auf ein weiteres Fenster zu. Im Umschnitt weht dann eine Gardine seitlich ausladend ins dunkle Innere einer Wohnung. Von unsichtbarer Hand geführt, öffnen sich Küchenschubladen und schwebt ein Küchengerät, halb Hammer, halb Messer, durch die Luft. Vasen fallen, Büsten stürzen, Bücher kippen, Spiegel zerspringen. Mit gewaltvollen Hieben zertrümmert das gespenstisch fliegende Werkzeug die Tasten eines Klaviers und zerritzt das Portrait eines schnurbärtigen, bebrillten Genossen. Als sich dieser Genosse und seine besorgten Nachbarn Zutritt zur Wohnung verschaffen, weht nur mehr die Gardine aus dem Fenster und nimmt im Verwehen die Kontur eines weiblichen Körpers an, der laut auflacht. Ein Stockwerk tiefer nimmt die Unsichtbare am Bett eines Kindes Platz und beginnt ein Märchen zu erzählen, in einem Spiegel sieht man das Gesicht Margaritas (Yuliya Snigir), die im dritten Akt als Hexe wiederkehren wird.
In dem Prolog von Michael Lockshins Der Meister und Margarita trifft somit die Lust an der Zerstörung und an der Kinetik der Gewalt (die sich als Racheakt entpuppen wird) auf ein Unbehagen und eine intime Geste. Dabei ist die schaurige Erscheinung hier eine andere als die merkwürdige Gestalt, die sich im ersten Kapitel der satirischen Romanvorlage von Michail Bulgakow an einem Frühlingstag am Rande des Moskauer Patriarchenteichs aus „heißer Luft“ kurzzeitig verdichtet, ein Begleiter des mephistophelischen Wolands (August Diehl), der daraufhin seinen ersten Auftritt hat und die Stadt ins Chaos stürzen wird. Lockshins Film eröffnet das Geschehen ausgehend von Margarita und rückt damit die Liebes- und Rachegeschichte der Vorlage zentral in den Fokus.
Verschlungene Erzählakte zwischen Rhetorik und Unterhaltung

Der Film Der Meister und Margarita entnimmt einzelne Versatzstücke aus der Romanvorlage und strukturiert sie als Abfolge mehrerer ineinander verschränkter Erzählakte: die Prologszene bringt der titelgebende „Meister“, der namenlose Schriftsteller (Jewgeni Zyganow) in der Zelle einer Irrenanstalt zu Papier. Seiner Zelle entkommen, steht er außen auf einem Rundgang des Gebäudes: und das gleich doppelt. Er sieht seinem anderen Ich zu, wie dieser zurück in die Nachbarzelle tritt und dem jungen Schriftsteller Ivan Bezdomny seine Lebensgeschichte erzählt: Das Theaterstück des Meisters über Pontius Pilatus ist abgesetzt – Historienfilm-Szenen von Pilatus (Claes Bang) und seiner Begegnung mit Yeshua, einer historischen Jesus-Figur, durchziehen den Film – und der Autor wird aus dem Schriftstellerverband geworfen. Der geheimnisvolle Woland (August Diehl) regt ihn dazu an, über den Teufel, der Moskau besucht, zu schreiben. Das historische Setting des stalinistischen Moskaus im ersten Akt bietet dabei eine Orientierung für die verschlungenen (Handlungs-)Stränge.
Es wird viel geredet in Lockshins Film. Hilflos sitzt der Meister vor einem Saal voller Schriftsteller und hört seinen Kritikern zu. Schließlich erhebt sich auch sein Publizist Berlioz vom Podium und verkündet, den Abdruck des Pilatus-Stückes zu vernichten. Der Einspruch des Meisters folgt in Form eines neuen literarischen Werks, das die verheiratete Margarita liest, die darin zur Heldin mit Superkräften wird. Einzelne Passagen daraus setzt der Film in Szene: so die fantastisch gewandelten Begegnungen der Kritiker mit dem teuflischen Woland, dem Professor für dunkle Magie. Gleich mehrfach wird Wolands plötzlicher Auftritt beim Patriarchenteich gezeigt, wenn er sich in eine Diskussion zwischen Berlioz und Bezdomny zum Atheismus einschaltet und ersterem seinen Tod voraussagt. Woland ist eine Paraderolle für Diehl, der das Wahnsinnige bereits in seinem Leinwanddebüt 23 – Nichts ist wie es scheint und das bedrohlich Durchdringende bereits in Inglorious Bastards markant verkörperte.

Der Meister und Margarita greift einzelne ikonische Momente, Bilder und Formulierungen seiner Vorlage heraus und folgt dabei einem Konstruktionsprinzip, das jenem so mancher Superhelden-Verfilmung ähnelt. Der Film zeigt dabei ein Gespür dafür, was es heißt, einen Klassiker des 20. Jahrhunderts für die Gegenwart des 21. Jahrhunderts zu adaptieren, indem er sich mit seiner Rachegeschichte an den Mustern des globalen Blockbusterkinos orientiert. Er weiß um die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte des Romans: geschrieben ab 1928, 1940 fertiggestellt, 1966 zensiert erschienen und direkt Kult geworden. Für den Film besteht kein Gegensatz zwischen populärer Unterhaltung und dem rhetorischen Plädoyer für (Kunst-)Freiheit. Das zeigt nicht zuletzt das Bild der brennenden Stadt, auf die das Liebespaar sowie Woland und sein aufgereihtes Gefolge, das schon das alte Rom hat untergehen lassen, – ein Joker, ein Schlächter, eine Vampirin und ein sprechender Kater – blicken. Die (widerständige) Gewalt ist hier eine durchaus teuflische Angelegenheit.
Das Gewicht der Verschwundenen

In Russland kam der von Oppositionellen gefeierte Film bereits Anfang 2024 in die Kinos und war ein herausragender kommerzieller Erfolg, trotz oder gerade wegen der Kritik von staatlicher Seite, die die Produktion noch 2021, vielleicht gedacht als global exportierbares Kulturgut, in großem Umfang gefördert hatte. Dass der Film auf eine geteilte Gegenwart abzielt, zeigt sich in seiner Darstellung der Irrenanstalt: Das überdimensionierte Bauwerk – eine von mehreren Überzeichnungen, die jegliche Ansätze einer historisch getreuen Architekturdarstellung unterlaufen – ist der zentrale groteske Ort des Films, historisches Sanatorium und dystopisches Gefängnis zugleich, und weckt Assoziationen sowohl zu Science-Fiction-Welten wie auch zu dem Schicksal Alexei Nawalnys. Das Gebäude aus der Zukunft spannt einen Horizont auf, bei dem die aktuelle Wirklichkeit des russischen Publikums zum Fluchtpunkt der verschiedenen dargestellten Zeiten und Orte wird.
Mehrfach thematisiert der Film das Verschwinden der Bewohner aus einem Mietshaus, in dem Woland und sein Gefolge eine Wohnung okkupieren. In Bulgakows Roman ist das Verschwinden der Mieter, die sich spurlos in Luft auflösen, geprägt von einem ironischen Tonfall, dessen Leichtigkeit zugleich als ihre Kehrseite die Schwere der Gewalt in sich trägt. Man mag Bulgakows Witz streckenweise vermissen: Dort wo bei Bulgakow lakonisch ein Kopf kullert, fliegt er im Film hoch empor, in Zeitlupe und Nahaufnahme. Das absurde Spektakel erscheint dabei zugleich als Mittel und als Zweck der filmischen Inszenierung. Die Frage, welches Gewicht man dem beizeiten schwerfälligen, meist aber überzeugenden Film beimisst, ist wohl eine der aktuellen Lebenswirklichkeit des jeweiligen Publikums.
Neue Kritiken

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother

The Day She Returns

Prénoms
Trailer zu „Der Meister und Margarita“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.