Das verlorene Gesicht – Kritik
Neu auf DVD: Eine von Panikattacken geplagte Frau liebt ihren Arzt, der selbst unter fremder Kontrolle steht. Kurt Hoffmanns Das verlorene Gesicht (1948) ist eine Mabuse-Geschichte für ottonormale Leute – und zeigt einmal mehr, wie fruchtbar das Nachkriegsdeutschland für Horrorfilme war.

Es beginnt mit einem Alptraum. Johanna (Marianne Hoppe) versteckt sich vor Verfolgern unter einem Wohnwagen. Breit in die Kamera grinsende Gesichter stellen sie jedoch in ihrem Schlupfloch. Hinter Gittern wird sie weggefahren. Nach dem Aufschrecken im Bett wird sie in einen Spiegel gucken, entsetzt von dem Gesicht, das sie dort sieht. Als sei es nicht ihr eigenes. Als würde die Maske, die an der Wand hinter ihr hängt, von ihr Besitz ergreifen wollen: eine grobe, hartkantige Gesichtsmaske, deren bestimmendes Merkmal die markanten Schlitze darstellen, zu denen die Augen verengt sind.
Nicht ohne Subtext

Das verlorene Gesicht handelt von Identitätsverlust und Fremdkontrolle. Es geht um Injektionen von Medikamenten, die Persönlichkeiten zur Auflösung bringen. Hypnotiseure, die Menschen mit ihren Blicken ihrer Macht unterwerfen. Um Menschen, die Jahre, Jahrzehnte unter einer fremden Identität mit fremdem Aussehen, fremder Sprache, ohne Gedächtnis dahinleben, nur um in einem Moment wieder zu „sich selbst“ zu werden. Bei einem deutschen Film, der 1948 in die Kinos kam, liegt dabei ein Subtext nahe: Eine ganze Nation hat eine historische Schuld auf sich geladen und ihr Gesicht verloren. Ganz unbewusst erzählt der Film davon, wie Demagogen andere Menschen zu Taten gegen deren eigenen Willen verführen. Wie jahrelang geschlafwandelt wird. 13 Jahre frischer Geschichte werden hier per traumgleicher Verdrängung wegschiebbar.

Erzählt wird von Johanna, die Thomas (Gustav Fröhlich) liebt. Den Arzt, der sie wegen ihrer Angstzustände und Panikattacken behandelt. Die Zuneigung ist gegenseitig, aber seine Injektionen führen nicht zur Linderung, sondern zur Verschlechterung ihres Zustands. Gleichzeitig untersucht Thomas’ Freund Axel (Paul Dahlke), ein Journalist, die merkwürdige Zerstreutheit seines Freundes und wird mit Bühnenkünstler und Hypnotiseur L’Arronge (Harald Mannl) darauf aufmerksam, dass Thomas unter fremder Kontrolle steht. Mittendrin: der dubiose Robert (Richard Häussler), dessen Augen von Macht und Hintersinn sprechen.

Es ist eine Art Dr.-Mabuse-Geschichte auf Ebene des Persönlichen, die da ansetzt, wo Fritz Lang 1933 mit Das Testament des Dr. Mabuse aufhörte. Was bedeutet, dass es nicht um die Verbrecher geht, die nach der Macht greifen, sondern um ottonormale Leute, denen diese entrissen wird. Was dazu führt, dass Gesichter den Film dominieren und in diesen vor allem die Augen. Mal starren sie potent, mal sind sie vor Schreck und Wahn eingefroren. Ob sie nun aber Aggressoren oder Ausdruck taumelnder Identitäten sind, zumeist sind sie weit aufgerissen. Wer seine Augen nicht mehr aufhalten kann, der hat schon verloren.
Fallstudie statt Paranoiathriller
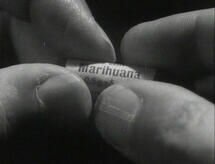
Das verlorene Gesicht ist einer dieser Filme, die spürbar machen, wie fruchtbar Nachkriegsdeutschland für Horrorfilme war. Vor allem wenn ein fantasiebegabter Regisseur wie Kurt Hoffmann wenig Sinn für Realität zeigt, sondern die Geschichte wie einen Traum erzählt. Aber ebenso zeigt sich, wie sehr sich davor gesträubt wird, alle Potenziale des Unbehagens zuzulassen. Denn sein Spiel betreibt der Film sehr offensichtlich. Wer hinter allem steckt, wird kaum vor dem Zuschauer versteckt. Als ginge es darum, die Schatten nicht zu groß werden zu lassen. Statt also gänzlich zum Paranoiathriller zu werden, kommt es schon mitten im Film zur kaum überraschenden Auflösung und einem radikalen Stimmungswechsel.

Dem Film vorangestellte Texttafeln weisen darauf hin, dass er sich auf Erkenntnisse der modernen Psychologie stützt und die kommende Geschichte mitnichten nur Fiktion ist, sondern auf dokumentierten Fällen aus den 1920er Jahren basiert. Schon auf den ersten Metern stellt Das verlorene Gesicht so das Bein aus, über das der Film stolpern wird. Nicht so sehr, weil Ärzte Marihuana als seltenes Kaktusgift bezeichnen werden, das bei regelmäßigem Gebrauch schwache Persönlichkeiten zum Zusammenbruch bringe, oder weil Hypnose als leichtgebräuchliche Gehirnkontrolle dargestellt wird. Nicht so sehr also, dass er es mit wissenschaftlicher Genauigkeit nicht so genau nimmt, sondern dass der Film in eine Fallstudie umschwenkt, ist das Problem.
Gemütlicher Grusel

Der erste Teil jagt so überstürzt auf die Auflösung zu und lässt die zerrütteten Psychen der Figuren viel zu schnell vom Haken eines für die Hast viel zu gut inszenierten Films. Und die zweite Hälfte, die sich als melodramatische Liebesgeschichte ankündigt, ist weniger an Gefühlen interessiert als am Ausbreiten einer netten wunderlichen Geschichte. Statt entsetzten und entgleisten Gesichtern und Augen herrschen nun verwunderte. Statt die Figuren weiter Bedrohungen und Ängsten auszusetzen, dürfen sie sich einen sonderbaren Fall anhören. Über eine Frau, die von der Polizei aufgegriffen wird, die erst gar nicht spricht, und wenn sie das Wort ergreift, kann niemand diese Sprache identifizieren. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt aber schon, wer diese Luscha ist.
Der beruhigende Abschluss zeigt bestenfalls, wie klein die Welt vor nicht allzu langer Zeit war. Wie mysteriös andere Erdteile noch waren. Wie fantastisch das andere Ende der Welt noch war. Das verlorene Gesicht ist letztlich aber ein Grusel, der es sich lieber gemütlich macht und sich damit begnügt, zeigen zu wollen, dass die Welt sonderbar ist – wo sie sich doch weitestgehend als Abgrund andeutete.
Neue Kritiken

Crocodile

Auslandsreise

AnyMart

Allegro Pastell
Trailer zu „Das verlorene Gesicht“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (11 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Tilman Baumgärtel
Was für Horrorfilme gibt es denn sonst noch im dt. Nachkriegskino?
Vaclav Demling
Ein später Vertreter dürfte sein: Arzt ohne Gewissen (1959): https://de.wikipedia.org/wiki/Arzt_ohne_Gewissen
Robert Wagner
Beispiele wären vll. Alraune, Rosen blühen auf dem Heidegrab, Die Nackte und der Satan oder Ein Toter hing im Netz. Aber mir ging es gar nicht so sehr um tatsächliche Horrorfilme, weil es sich ja - wie in der Gegenbewegung im Film beschrieben - dann auch gern verwehrt wurde, wirklich unbehaglich zu werden. Eher um die emotionale Aufgekratztheit, wie sie in Gefangene der Liebe oder so zu finden ist. Und diese klammen Momente vor allem in Heimatfilmen. Die Version von Das Schweigen im Walde von 1955 hat beispielsweise diesen tollen Moment genau in der Mitte des Films. Alles Drama, alles Aufregende wurde an Anfang und Ende der Handlung gequetscht. Und hier sollte alles beruhigend und schön sein. Rudolf Lenz ist in der Waldhütte der Frau, die er liebt. Sie bringt ihren kleinen Bruder gerade ins Bett und hinter ihr geht langsam die Tür auf. Es soll eine ephemere Erleuchtung sein, wie sich diese reine, schöne Frau vor ihm offenbart ... aber es wirkt vor allem gruselig, wie sich die Tür öffnet, wie er sie anstarrt. Es schwingt immer etwas mit, dass nicht ausgesprochen wird. Deutschland hätte viele tolle Horrorfilme herausbringen können, denke ich vielmehr, wenn mehr Mut dagewesen wäre, all dem in die Augen zu sehen, vor dem lieber die Augen verschlossen wurde.


















3 Kommentare