Careless Crime – Kritik
Shahram Mokri erzählt von einem tödlichen Brandanschlag auf ein iranisches Kino, interessiert sich aber spürbar mehr für Zeitschleifen-Mindfucks. Das eigentlich Subversive an Careless Crime steckt jedoch in ganz unscheinbaren Szenen.

Lav Diaz – das ist doch der, der immer so lange Filme macht. M. Night Shyamalan – das ist der mit den krassen Twists. Asghar Farhadi – der mit den extrem komplexen Schuld-Dramen. Spätestens mit Careless Crime (Jenayat-e bi deghat, 2020) ist auch Farhadis Landsmann Shahram Mokri dabei, sich ein solches Markenzeichen zu erarbeiten. Mokri war bislang vor allem für Fish & Cat (Mahi va gorbeh, 2013) bekannt – eine iranische Hommage an amerikanische Backwood-Slasherfilme, die sich aber letztlich weniger auf ihren Horror-Plot fokussiert als auf das Experimentieren mit Zeitebenen, die sich so seltsam verbiegen und ineinander verschieben wie Raumebenen in den Bildern von M.C. Escher. Zum Erfolg dieses mehrfach prämierten Films trug sicherlich auch die Tatsache bei, dass er in einem kontinuierlichen Take, also ohne einen einzigen Schnitt gedreht wurde. Mokris nächstes Werk, Invasion (Hojoom, 2017), war ebenfalls ein One-Take-Film voller chronologischer Verschiebungen.
Zeit als Möbiusband

In Careless Crime verzichtet Mokri zwar auf das One-Shot-Element, bleibt seinem Faible für narrative Zeitverschmelzungen aber treu. Ausgangspunkt ist ein realer Kriminalfall aus dem Jahr 1978: Damals, kurz vor der islamischen Revolution, starben 422 Menschen bei einem Brandanschlag auf ein iranisches Kino. Ein Handlungsstrang reinszeniert – oder reimaginiert – dieses Verbrechen. Ein anderer Strang folgt einer Gruppe junger Menschen, die dem fatalen Kinoabend beiwohnen. Diese beiden Ebenen scheinen mal im Jahr 1978 zu spielen und mal im Jahr 2020. Beim dritten Strang handelt es sich um einen im Jahr 2020 angesiedelten Film-im-Film, in dem zwei Studentinnen einen Film-im-Film-im-Film aufführen wollen – und zwar denselben Film, bei dessen Vorführung der Anschlag vor 42 Jahren stattfand.
Man kann das als komplex bezeichnen – oder als wirr. Aber das Narrative steht hier ohnehin nicht im Vordergrund: Mokri füllt die Handlung bewusst mit banalen Gesprächen, langwierigen Warte-Situationen und Seitenschauplätzen, die zu wenig führen. Der Plot scheint ihm eher als Vehikel zu dienen, um seine Kunstfertigkeit im Jonglieren mit verschiedenen Zeitebenen zu demonstrieren: Eben reden die Brandstifter noch darüber, dass der Schah bald die Macht verlieren wird – kurz danach betreten sie ein Kino, in dem junge Menschen auf Smartphones starren. Besonders große Freude bereiten Mokri anscheinend möbiusbandartige Zeitschleifen: Szenen wiederholen sich in verschiedenen Jahrzehnten, bereits bekannte Dialoge kehren in neuen Kontexten wieder, einzelne Drehbuchzeilen werden mantraartig wieder und wieder deklamiert.
Markenzeichen oder Schublade?

Weitere Verfremdungseffekte verstärken die Desorientierung noch: Mehrfach blendet Mokri den Zuschauer mit gleißendem Licht, die Kamera irrlichtert mitunter scheinbar ziellos umher, und immer wieder mischen sich surreale Einsprengsel in die Szenen – mal ist es ein am Himmel befestigtes Seil, mal ein Sack mit übernatürlichen Fähigkeiten. Hinzu kommen MacGuffins wie eine nicht explodierende Bombe oder nicht-spiegelnde Spiegel, die gezielt als Metaphern ausgestellt werden, aber extrem vage bleiben – soll sich der Zuschauer halt was dabei denken.
Ob man all das nun für verdammt clever oder Gimmick-Overkill hält, hängt möglicherweise davon ab, ob es der erste Mokri-Film für einen ist oder ob man zum dritten oder vierten Mal Zeuge sehr ähnlicher Zaubertricks wird. Beim ersten Mal mag Mokris komplexe Struktur Bewunderung evozieren – beim dritten Mal wird man den Verdacht nicht los, einem One-Trick-Pony zuzusehen. Was Mokri als Markenzeichen intendiert, kann auch wie ein Korsett wirken oder wie eine Schublade, in die sich der Regisseur selbst steckt. Mokri erfüllt die Erwartungen seiner Anhänger, indem Careless Crime die sonst üblichen Erwartungen an narrative Kohärenz immer wieder unterläuft.
Flirten als „careless crime“

In politischer Hinsicht ist Mokris Vermischung der Zeitebenen allerdings tatsächlich eine schlaue Lösung für ein Dilemma, das iranischen Regisseuren immer wieder begegnet: Da Teile des Films vor der islamischen Revolution spielen, müsste er – wenn es ihm denn um historische Authentizität ginge – Frauen aus dem westlich geprägten Bildungsbürgertum eigentlich ohne Kopftuch zeigen. Allerdings geht das natürlich aufgrund heutiger Vorschriften nicht, sodass Regisseure gezwungen sind, historische Zustände vor 1979 zu verfälschen. Indem Mokri hier die Zeiten ineinander faltet und ununterscheidbar macht, entzieht er sich dieser Falle.
Und nicht nur das: Das eigentlich Subversive an Careless Crime sind vielleicht gar nicht die bemühten Experimente mit nicht-linearen Chronologien, sondern ganz unscheinbare Szenen, in denen sich junge Frauen und Männer ungezwungen miteinander in der Öffentlichkeit treffen, über Dates reden, flirten und sich gegenseitig necken. In den Augen der iranischen Religionspolizei mag das ein „careless crime“ sein. Für den Zuschauer hingegen lüftet sich in diesen Szenen einmal der Schleier einer staatlichen Ideologie, die großen Teilen der iranischen Bevölkerung aufgezwungen wird.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Careless Crime“

Trailer ansehen (1)
Bilder


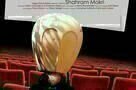

zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.










