Gelobt sei Gott – Kritik
Relevante Themen statt subversive Deutungen. François Ozon erzählt in Gelobt sei Gott einen realen Vergewaltigungsskandal in der katholischen Kirche nach. Dabei geht er eher in die Breite denn in die Tiefe.

Am Premierentag von François Ozons Wettbewerbs-Beitrag Gelobt sei Gott (Grace à dieu) berichtet die taz ganzseitig über Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche. Ich lese, bevor das Licht im Saal ausgeht. Die Dunkelheit wirkt wie eine Schwarzblende: Der Film beginnt, wie der Artikel endete, das Thema ist die Brücke. Es geht um den Kampf um späte Strafe für pädophile Priester und spätes Recht für traumatisierte Kinder. Soweit, so Berlinale: Wir sind im Bereich des Tagesaktuellen.
In drei Akten, anhand dreier Hauptfiguren, die in ihrer Jugend von Pfarrer Preynat (Bernard Verley) missbraucht wurden, moduliert der Film den Topos männlicher Opfererfahrung: Vom bürgerlichen zum aktivistischen zum melodramatischen Typ. Angefangen mit dem Geschäftsmann Alexandre (Melvil Poupaud), der als braver Katholik die Kirche zur läuternden Einsicht bugsieren will, über den Atheisten François (Denis Ménochet), der eine Opfervereinigung gründet und die Medien einschaltet, bis zum kaputten Rockertypen Emmanuel (Swann Arlaud), der immer knapp am Zusammenbruch sein vom Trauma zerfressenes Leben zusammenzuhalten versucht.
Unter den Augen Christi

Am besten steht dem Film der No-Bullshit-Stil des ersten Drittels, das schön nuanciert zwischen weltlicher Betriebsamkeit im Kampf um Aufarbeitung und geistlichen Zweifel changiert. Da zeigt sich Ozon mal wieder als der professionelle moralische Dialektiker, der die frivolen bis perversen Kanten seines Frühwerks nur scheinbar zu leicht konsumierbarem Konsumkino geschliffen hat. Wenn Ozon gut ist, ist stets irgendwas angenehm off in seinen auf den ersten Blick routiniert runtererzählten Geschichten. Das ist diesmal zum einen die enorme Erzähldichte, die lustvoll exzessiv auf das angestaubte Mittel Voice-over setzt – nicht, um faul zu erzählen, was die Bilder nicht zeigen, sondern um die Geschichte doppelt so schnell und doppelt so dicht voranzutreiben, einmal in Wort und einmal im Bild. Zum anderen arbeitet Ozon schön heraus, wie sich die heuchlerische Vergebungsmaschinerie der katholischen Kirchen vor den schmutzigen Menscheleien des Leibes in die transzendente Welt der Rituale und sakralen Architektur verdrücken will.
Alexandre wird auf Betreiben der Kirche mit seinem Peiniger konfrontiert. Der gesteht unumwunden alles. Und bittet dann zum gemeinsamen Gebet, unter den leidvollen Augen Christi am Kreuz. Die individuelle Schuld löst sich in der untilgbaren, allursprünglichen Erbsünde auf wie ein Blutstropfen im Ozean, vage Erhabenheit entkräftet einen demgegenüber kleinlichen, prosaischen Schmerz. Das ist der Moment, in dem Alexandres Drang zu Gerechtigkeit absolut und sein Zweifel am Aufarbeitungswillen der Kirche manifest wird. Hohl hallt das Vaterunser wider, wie eine große Entschuldungsbeschwörung, ein Hohn. Und die von heimeligem Kerzenschein und bunten Bleigläsern erleuchteten Sakralbauten, die der Film anfangs noch visuell bombastreich in Szene gesetzt hat, werden zu Lügengebäuden, das graue winterliche Alltagslicht der übrigen Szenen bald der einzig fade Glanz der Welt.
Panorama männlicher Opfergesten

Andere erzählerische Widerhaken allerdings bleiben eigenartig diffus, unausgearbeitet, unklar. So gibt es zwei nur angerissene Erzählungen von Frauen, die auch Opfer sexueller Gewalt wurden, aber die nie aktiv wurden. Kurz scheint da die verwirrende Lesart auf, dass die sich um männliche Opfer kreisende Debatte um vergewaltigende Priester vielleicht viel grundlegendere Probleme um misogynen Missbrauch verdrängen. Aber es bleiben zwei lose verbundene Momente, nicht einmal ein Seitenstrang. Ebenso evoziert der Film hie und da die Shoa als Referenzfolie für die Opfererfahrung der jungen Katholiken, aber auch hier bleibt unklar, wie das gemeint sein könnte.
Insgesamt ist Gelobt sei Gott einerseits formlos, andererseits konventionell. Der erzählerische Hyperpragmatismus des Beginns wird im Verlaufe der zwei folgenden Kapitel immer panoramatischer ausgeweitet, die emotionale Zurückhaltung immer mehr zugunsten rein psychologisierender Charaktermomente aufgegeben. Übrig bleibt zuletzt eine ziemlich unaufregende Form von Erzählkino, die lieber illustriert als deutet, mehr der außerfilmischen Nachrichtenrealität als der filmischen Poetik verpflichtet ist. Und vom früher manchmal virtuosen Künstler der Hintergründigkeit Ozon bleibt nur mehr der ökonomische Routinier übrig, der zu zahm und zu brav geworden ist, um die Untiefen seiner Themen und Figuren ernsthaft auszuloten. Wichtiger scheint, relevant zu bleiben: Ein abschließender Textbildschirm kündigt den nächsten Gerichtsprozess im realen Fall Preynat für einen Monat nach der Premierenfeier an.
Neue Kritiken

Primate

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail
Trailer zu „Gelobt sei Gott“


Trailer ansehen (2)
Bilder

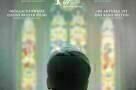


zur Galerie (14 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.




















