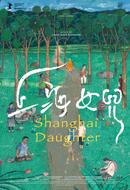Black Box – Kritik
Die paranoide Suche nach dem Antagonisten. In einem abgerieglten Wohnhaus lässt Aslı Özges Black Box machtlose Mieter aufeinander los, während im Hintergrund etwas anderes den Gang der Dinge bestimmt.

Aslı Özges neuer Film spielt in einem großstädtischen Häuserblock und dessen Hinterhof. Zunächst wird dort die titelgebende Black Box hineingehievt, ein Container, in dem Hausverwaltung und Miteigentümer in Personalunion Stellung beziehen. Dann wird der Ausnahmezustand verhängt. Der Hof wird polizeilich abgeriegelt, alle wollen hinaus und dürfen es nicht. Was ist geschehen? Und mehr noch: Wer trägt die Schuld?

Das Ensemble der Mieter*innen tritt zusammen und findet schnell zum Gerüchtekochen, zu Verschworenheiten, Aktionismus, Opportunismus oder Gleichmut. Jede Wohnung bietet andere Perspektiven auf das Haus, den Hof, die anderen Parteien und die Probleme vor Ort. Noch vor dem Polizeieinsatz sind da störende Mülltonnen, marode Treppenhäuser, verdächtige Nachbarn und Verkaufsgerüchte. Auf einen Nenner gebracht: die fehlende Handhabe über den Raum, in dem man lebt. Die Sperrung des Hofs verdichtet all das.
Der Lehrer Erik (Christian Berkel), ein Querulant und Quälgeist, wie man ihn sich auf der eigenen Seite wünschen muss, startet eine Mieterinitiative gegen den Hausverwalter, die Reaktionen darauf fallen sehr unterschiedlich aus.
Henrike (Luise Heyer), erschlagen von anstehendem Bewerbungsgespräch, anhänglichem Sohnemann und paternalistischem Gatten (Sascha Alexander Gersak), möchte nur hinaus und zeigt sich konziliant. Gut ein Dutzend Figuren bilden das gekonnt ausbalancierte Ensemble von Black Box.
Keiner von ihnen blicken wir ganz in den Kopf hinein, so ist der Film im besten Sinne ungemütlich. Müssen wir uns doch zähneknirschend auch mit den raumgreifenden, vernünftelnden, herablassenden Seiten dieser Leute arrangieren – wie im öffentlichen Raum eben. Viele werden verdächtigt, schuld zu sein am allen zusetzenden Ausnahmezustand. So entsteht echte Spannung, vor allem im Nichtwissen um die Motive.
Vom Teufel besessen

Ein Kernmerkmal vieler guter Thriller, die paranoide Suche nach den Antagonisten: Diese Suche erfüllt eine geniale Doppelfunktion in Black Box. Zum einen ist sie Thrillerelement, zum anderen führt sie dazu, dass machtlose Mieter*innen panisch aufeinander hacken, während im Hintergrund etwas anderes den Gang der Dinge bestimmt: das System des Mietens, personifiziert vom Hausverwalter (Felix Kramer), der nicht zufällig Horn heißt.
Er repräsentiert keinen Vermieter und dessen Eigeninteressen, sondern das pure Machtgefälle zwischen den beiden Polen des Mietverhältnisses. Horn erklärt seine Absichten verständnisvoll – und dabei ist auch eine Politik zu denken, von der man in letzter Zeit häufiger vernimmt, sie müsse sich selbst besser erklären –, wo doch das Sich-Erklären meist nur letzter Schritt der Machtausübung ist. Und auf der anderen Seite die Mieter*innen, die kaum von den anstehenden Verkäufen ihrer eigenen Wohnungen wissen und sich auch darin noch gegenseitig die Butter vom Brot nehmen müssen.

Der sich stoisch gebende, Verständnis performende Horn beschwört ein nachbarschaftliches „Wir“, das es zu schützen gilt vor Kriminalitätsraten, Diebstählen, Terror, wenn es sein muss. Was würde nicht verzwergen im Angesicht des Primats der Sicherheit? Manchmal liegen im Film noch Masken auf den Gesichtern, man spricht über die nicht lang zurückliegende Pandemie und hofft schon wieder auf eine Zeit nach dem Ausnahmezustand. Ein Nach, das wir kennen: die nächste Krise, die nächste Vertröstung, weshalb das Geld nicht für Inflationsausgleich, Infrastrukturausbau, Kindergrundsicherung ausgegeben wird. Stattdessen: Wehrhaftigkeit. Man muss eben das nächste Loch in den Gürtel stanzen, um ihn wieder einmal enger zu schnallen. Oder, in den Bildern des Films: Bauen wir einen Zaun um den Hof, um die Mülltonnen und das marode Fundament kümmern wir uns später, später, später ...
Derweil finden sich schnell Sündenböcke. Wer vage ausländisch aussieht, wird hier vom entkultivierten Bürgertum entspannt vorverurteilt. Abdul Kader Chahin trug vor Kurzem in der Elbphilharmonie einen bemerkenswerten Text über „die Häuser mit den 200 Klingelschildern“ vor. Darin heißt es: „Sie wünschen sich, dass Leute wie ich – wer auch immer das ist – in den Konzernvorständen sitzen. In den Konzernvorständen, denen die Häuser mit den Klingelschildern gehören.“

In Aslı Özges Film sind es weniger als 200 Klingelschilder, dennoch ist es kein Film über Einzelidentitäten, sondern darüber, was es heißt, einen Ort zu bewohnen. Fast alle Figuren in Black Box verhalten sich das eine oder andere Mal unsolidarisch; die ökonomischen, sozialen, persönlichen Gründe liegen dabei so offen zutage, dass es schmerzt. Auf faszinierend eigenartige Weise gelingt es Özge im Finale dennoch, eine Schneise für das Zeigen von Größe zu schlagen.
Neue Kritiken

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice

Ungeduld des Herzens

Melania
Trailer zu „Black Box“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (11 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.