Ballade von der weissen Kuh – Kritik
Minas Mann wird durch einen Justizfehler hingerichtet, obwohl er unschuldig ist. Das iranische Drama Ballade von der weißen Kuh zeigt den Kampf einer Frau gegen den Unrechtsstaat und scheut sich nicht vor provokanten Frontalangriffen aufs Regime.

In den letzten zehn Jahren ging der Goldene Bär der Berlinale gleich dreimal an iranische Filme: 2011 an Asghar Farhadis Nader und Simin – Eine Trennung, 2015 an Jafar Panahiss Taxi Teheran und letztes Jahr an Mohammad Rasoulofs Todesstrafe-Drama Doch das Böse gibt es nicht. Und es wäre nicht verwunderlich, wenn auch 2021 wieder ein iranisches Werk mit dem Hauptpreis der Berlinale ausgezeichnet werden würde. Ballade von der weißen Kuh (Ghasideyeh gave sefid) reiht sich nahtlos ein in die lange Liste dringlicher, fesselnder Dramen, die die Festival-Kuratoren im Iran entdeckt haben. Im Film von Behtash Sanaeeha und Maryam Moghaddam geht es – wie auch in Doch das Böse gibt es nicht, I’m not angry (2014) oder Lantouri (2016) – um die Todesstrafe, die nur in China häufiger vollstreckt wird als im Iran. Ein Jahr nachdem ihr Mann Babak exekutiert wurde, wird Mina (Co-Regisseurin Maryam Moghaddam) noch einmal zum Gerichtshof gebeten. „Ihr Mann war unschuldig. Wir haben einen Fehler gemacht – das tut uns sehr leid“, erklärt ihr einer der Richter trocken. Dennoch, führt er weiter aus, muss Babaks Tod ja Allahs Wille gewesen sein, sonst wäre der juristische Fehler schließlich nicht passiert. Und sowieso: Sie wird ja entschädigt – und zwar mit der Höchstsumme, die der Staat in solchen Fällen zahlt.
Schuld und die Macht der Vergebung

Kurz darauf ereilen Mina noch zwei weitere Schicksalsschläge. Hier holt der dramatische Bogen ein bisschen weit aus – das Erscheinen Rezas (Alireza Sanifa) an Minas Haustür hätte an sich gereicht. Reza gibt sich als früherer Freund Babaks aus, der Schulden zurückzahlen will. Doch als er Mina nicht nur das Geld überweist, sondern auch noch eine neue Wohnung für sie und ihre taubstumme Tochter Bita (Avin Purraoufi) besorgt und sich auch sonst aufwendig um die beiden kümmert, wird rasch klar, dass es um mehr geht als um eine finanzielle Schuld.
Wie das Filmteam dieses Werk an den iranischen Zensoren vorbei zur Berlinale gebracht hat, wäre ein spannendes Thema für einen eigenen Film. Ballade von der weißen Kuh greift das politische System nämlich noch direkter an als etwa die Filme von Mohammad Rasoulof oder Jafar Panahi, die beide unter Hausarrest gestellt und mit einem Arbeitsverbot belegt wurden. Das Regie-Duo Sanaeeha und Moghaddam macht die Ungerechtigkeit am Justizsystem fest: Anders als in Doch das Böse gibt es nicht geht es dabei nicht um die kleinen Fische, die Befehle ausführen und Todesstrafen vollstrecken, sondern um Richter – also jene, die die Entscheidung treffen, einem Menschen im Namen des Staates das Leben zu nehmen.
Sämtliche staatliche Gebäude wie Gerichte, Schulen und Ämter unterscheiden sich in diesem Film architektonisch nur geringfügig von dem Gefängnis, in dem Babak saß: Es sind große graue Klötze mit Gitterstangen vor den Fenstern und Mauern rings um das Grundstück. Auf diese Weise stellt Ballade von der weißen Kuh den gesamten Staatsapparat wie ein einziges großes Gefängnis dar – ein Gefängnis, in dem den Opfern des Unrechtsstaats nur die Macht der Vergebung bleibt, um gesellschaftliche Hierarchien umzudrehen.
Das Private ist politisch

Auffällig ist auch, dass sich sämtliche private Sorgen Minas direkt aus den politischen Zuständen ergeben. Ihre Probleme wären außerhalb des Irans keine Probleme. Wie man diese bedrückende Lage aushält, verrät Minas Nachbarin in einer Szene: „Manche nehmen Drogen, manche betrinken sich, manche gucken türkische Serien.“ Ballade von der weißen Kuh zeigt eine Gesellschaft, in der trauernde Männer und Frauen einander nicht mal umarmen können, wenn sie nicht verheiratet oder verwandt sind – eine Gesellschaft, in der Frauen vor Gericht einen männlichen Vormund brauchen und in der Witwen auf einer Stufe mit Junkies und (im Islam als unrein erachteten) Hunden stehen, wie es eine Nebenfigur einmal ausdrückt – eine Gesellschaft, die Mitläufer zu Mitschuldigen macht, zu Teilen des Systems.
Die Tür aufstoßen

Der Film belässt es nicht bei diesem vernichtenden Urteil, sondern fordert das iranische Zensursystem auch mit vielen kleinen Details heraus: Minas Tochter Bita ist etwa nach einem prä-revolutionären Film benannt, dessen Hauptrolle von der Sängerin Googoosh gespielt wird, die inzwischen in den USA lebt, da Sängerinnen nach der islamischen Revolution nicht mehr öffentlich auftreten durften. Wir sehen einen kurzen Ausschnitt aus diesem alten Film, in dem Frauen – wie damals üblich – ohne Kopftuch zu sehen sind. Der Höhepunkt der Provokation folgt aber in einer späteren Szene von Ballade von der weißen Kuh – einer Szene, die für westliche Sehgewohnheiten völlig unscheinbar wirken mag, die aber innerhalb der post-revolutionären Filmgeschichte des Irans ziemlich einmalig ist und in der all der Mut und die Wut dieses Films kulminieren: Wir sehen, wie Mina vor einer Tür steht, zögert und sich dann doch entschließt, durch sie zu schreiten – mit Lippenstift und ohne Kopftuch.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Ballade von der weissen Kuh“

Trailer ansehen (1)
Bilder


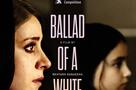

zur Galerie (8 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.












