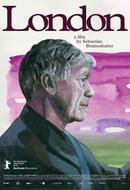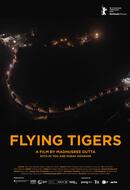Aheds Knie – Kritik
VoD: Das Heimatland beleidigen, die Oase besudeln, Kamera und Protagonist zum Tanzpaar erklären. In Ahed's Knee filmt sich der israelische Regisseur Nadav Lapid in Rage.

Nadav Lapid ist zurück in Israel, dem Land, das seine Hauptfigur Yoav aus Synonymes (2019) so leidenschaftlich, mit voller Verbalkraft gehasst und verlassen hat. Hier scheint alles wie ausgetauscht, als würde erstmal nicht so viel von diesem Wirbelwind eines Films bleiben. Der junge, stürmende und drängende Yoav wird zum grauhaarigen Filmregisseur Y. (Avshalom Pollak). Der leuchtend senfgelbe Mantel wird zur neutralen schwarzen Lederjacke samt Hemd, und der wütende Blick bekommt eine undurchsichtige Sonnenbrille verpasst. Der endlos auf frisch gelerntem Französisch plappernde Mund weicht einer zurückhaltenden hebräischen Sprache, die wenig von sich erzählt, nur erstmal etwas von anderen wissen will. So von der jungen Yahalom (Nur Fibak), die die örtliche Bibliothek in einem Dorf in der Arava-Wüste leitet und Y. eingeladen hat, dort seinen letzten, renommierten Film zu zeigen, der schon in Berlin seine Premiere feierte.
Die Kamera als Tanzpartner

Doch etwas in Lapids neuem Film Aheds Knie insistiert vehement auf einer inneren Unruhe: Der Gegenschuss auf Yahalom kann sich nie lange konzentrieren, schwenkt mit wilder Bewegung um 180 Grad unablässig hinaus auf die Wüste draußen vor dem Fenster – als würde schon die bloße Anwesenheit dieses Geländes schlicht nicht zu ertragen sein. Ein Blick, der sich an etwas stört, sich unablässig an etwas abarbeitet, eine einzigartige nervöse Energie ausstrahlt. Ein Blick, der auch schon Yoav aus Lapids Synonymes durch die Straßen von Paris begleitete, während sich dessen Sprache in neuen hasserfüllten Adjektiven überschlug. Die Kamera als Kontinuität inmitten aller filmischen Gegenentwürfe, die Aheds Knie zu Beginn gegenüber seinem Vorgänger behauptet.
Man müsste diesen nervösen Blick wohl inzwischen als Lapids Trademark verstehen, denn er folgt einer eigenen Logik. Manchmal imitiert die Kamera die Blicke der Figuren als eine Art pantomimisches Gegenüber, das durch die kleine Verzögerung der Bewegung schon wieder eine eigene Subjektivität ausdrückt. Dann wieder scheint sie das Innenleben dieser Figuren vorauszuahnen, wenn dieses vom Spiel der Darsteller noch nicht an die Oberfläche gebracht wurde. Ein eigenständiger Blick, der trotzdem nicht ohne das jeweilige Gegenüber gedacht werden kann. Den besten Vergleich liefert wohl der Film selbst, der Kamera und Y. nur eine Szene später gemeinsam durch die Arava-Wüste zu Vanessa Paradis’ Hit Be My Baby tanzen lässt. Y. schlägt Pirouetten, die Kamera irgendwann auch, bevor sie wie in einer Hebefigur in die Lüfte fliegt und dem Regisseur weiter oben beim Herumzappeln zusieht.
Ins hässliche Israel pissen

Offensichtlich ist es Lapid ein Anliegen, seine filmische Form derart in den Mittelpunkt zu rücken. Und diese Haltung teilt er mit seinem Protagonisten, der sich spätestens hier vollends als ein weiteres Alter Ego Lapids offenbart: „Just pay attention to the style“, rät Y. seinem Publikum, bevor der Film gezeigt wird. Denkt man Y. und Yoav tatsächlich als Kontinuität, ist dieser Style dann eben nicht nur Selbstzweck, sondern so etwas wie ein treuer Begleiter durch die zwischen diesen Filmen vergangene Zeit hindurch. Ein Begleiter, der ihn nie verlassen hat, weil es das Unbehagen gegenüber dem eigenen Heimatland auch nie getan hat: Jeder Schwenk also landet auf der Arava-Wüste, die Y.’s Appartement umzingelt und die hier in ihrer grauen Kargheit betont hässlich gehalten ist. Die Sonne spendet keine warme Atmosphäre, sondern überbelichtet leicht, um alles noch mehr ins Grau zu stürzen. Und die einzige Oase, die Y. auf Empfehlung von Yahalom besucht, nutzt er direkt, um auf den Boden zu pissen.
Die eigentliche Motivation für die Wiederkehr der Unruhe ist aber das Gespräch mit Yahalom selbst, die eine Liste für das israelische Kulturministerium vorlegt, in der die Gesprächsthemen für das an die Vorführung anschließende Gespräch festgelegt werden sollen. Angekreuzt werden können vor allem harmlose Themen, kritischere müssen manuell hinzugefügt und dann offiziell genehmigt werden. Eine Praxis, von der mir nicht ganz klar ist, ob es sie unter Kulturministerin Miri Regev, die bis 2020 im Amt war, tatsächlich so gegeben hat. Angesichts von Aussagen wie „Wenn ich zensieren muss, zensiere ich.“ gegenüber Künstler*innen, die offen die israelische (Kultur-)Politik kritisieren, wären solche Methoden aber durchaus denkbar.
Dieses Ministerium nervt jedenfalls an allen Fronten: Wenn nicht gerade eine Diskussion um das Formular entsteht, ist Y. an seinem Handy, um mit der Produzentin die Finanzierungsschwierigkeiten für seinen neuen Film „The Knee of Ahed Tamimi“ zu klären, der die Geschichte der gleichnamigen Aktivistin aus Palästina erzählen soll. Stück für Stück sehen wir dabei zu, wie Lapid die Kargheit dieser Gegend mit der steigenden Wut seines Protagonisten auffüllt, wie sich langsam erste Wortgefechte in der Leere ausbreiten.
Sich in Rage und Freiheit reden

Dass dieses so scharf gegen die israelische Politik gefilmte Werk mit der Finanzierung des Kulturministeriums erst entstehen konnte, nimmt der Steigerungsbewegung zugegebenermaßen ein wenig den Schwung, ist letztlich aber auch keine schlechte Nachricht für die Kulturschaffenden des Landes. Und dass Aheds Knie von öffentlicher Seite gefördert wurde, ist durchaus bemerkenswert, denn Lapid hat an Spitzen gegen sein Heimatland wieder so einiges parat: Immer mehr kocht hier hoch, immer mehr Lapid’sche Motive drängen sich in den Vordergrund.
Irgendwann macht sich Y’s Armeetrauma im Film breit: eine Anekdote über die Treue zum Vaterland bis in den Tod, die nicht einmal das Gefecht mit dem Feind braucht, sondern nur die hypervirile Performance und Kadertreue der israelischen Soldaten untereinander – unweigerliche Reminiszenzen an die Polizisten aus Policeman (2011). Und schlussendlich darf Lapids Protagonist seine ganze Wut wieder in eine kathartische Hasstirade stecken, in der sich die Beleidigungen gegen Israel grenzenlos überschlagen dürfen. Dann trägt Lapid nicht nur seinen Style, die Verweise innerhalb der eigenen Filmografie vor sich her, sondern auch sein Recht darauf, in Freiheit zu inszenieren.
Der Film steht bis 15.05.2024 in der Arte-Mediathek.
Neue Kritiken

Allegro Pastell

A Prayer for the Dying

Gelbe Briefe

"Wuthering Heights" - Sturmhöhe
Trailer zu „Aheds Knie“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (8 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.