Auf trockenen Gräsern – Kritik
Unwirtlich ist die Welt im neuen Film von Nuri Bilge Ceylan nicht nur für Frauen. Zwischen kargen Winterlandschaften und Tee trinkenden Männern zeichnet der türkische Regisseur das Porträt eines Misanthropen und einer abgehängten Region.

Es sind zwei Bilder, die einem die dreistündige Bildgewalt von Auf trockenen Gräsern (Kuru Otlar Üstüne) ins Gedächtnis einbrennt. Das erste, das sich in vielen Abwandlungen durch den Film zieht, eröffnet ihn: Ein Mann stapft durch den Schnee, bahnt sich einen Weg durch eine unwirtliche Winterlandschaft. Ehe wir erfahren können, dass sich Samet (Deniz Celiloğlu) nur widerwillig in der Region niedergelassen hat, sind es erstmal die Kräfte der Natur, die ihn hier ablehnen: die dicht wirbelnden Schneeflocken, die ihn den Kopf wie in Ehrfurcht senken lassen, der hochgetürmte Schnee, dem er jeden Schritt, überhaupt einen Weg mühsam abringen muss. Die Ablehnung ist beidseitig: Samet, der als junger Kunstlehrer zum Dienst in diesem abgelegenen Dorf im Osten der Türkei beordert wurde, wartet nur darauf, sich nach Istanbul versetzen lassen zu können.
Störgefühle und Verdachtsmomente

Das zweite Bild zieht sich ebenfalls in zahlreichen Abwandlungen durch den Film: Männer, die an einem Tisch sitzen, Tee trinken und sich (lange) unterhalten (Auf trockenen Gräsern hat eine Vorliebe für mäandernde Gespräche). Man könnte meinen, dass beide Bilder einen Kontrast herstellen sollen: hier die stilisierte Landschaft, da die naturalistischen Dialoge; hier die Weite, da die Enge; hier die Einsamkeit, da die Geselligkeit; hier die Kälte, da die Wärme; hier die Stille, da das Wort. Tatsächlich aber ergänzen sich beide Bilder zum immer bedrückenderen Porträt einer abgehängten Region, einer angeknacksten Männlichkeit und eines unsympathischen Mannes. Die Tee-Geselligkeit bietet keine Zuflucht vor der Unwirtlichkeit, sie ist vielmehr Teil davon.

Unwirtlich ist die Welt in diesem Film erstmal für Frauen und Mädchen. Einen wesentlichen Teil der Handlung – und des Prozesses, in dem Samet sich und die soziale Verachtung, die er für die Bewohner der Region übrighat, offenbart – setzt Samets Schülerin Sevim (Ece Bağcı) in Gang, als sie Samet unangemessenes Verhalten vorwirft. Die Vorwürfe werden nicht näher erläutert (die Szene beim Direktor der Schulbehörde mutet kafkaesk an – um Sevim zu schützen, könne er nicht näher darauf eingehen, was Samet vorgeworfen wird), der Film streut Störgefühle und Verdachtsmomente ein, aber es geht eigentlich nicht darum, ob etwas passiert ist, sondern um die Selbsterhaltungskräfte, die sofort am Werk sind, wenn ein Ruck durch die gefestigte Welt geht, in der das Mannsein mit dem Innehaben von Autorität zusammenfällt.

Zu keinem Zeitpunkt stehen die Bedürfnisse des möglichen Opfers im Fokus. Stattdessen: pubertär anmutende Geniertheit (dem Schulleiter und dem Direktor der Schulbehörde „fällt es schwer, darüber zu sprechen“ – nicht, weil sie entsetzt sind, sondern weil ihnen das Thema peinlich ist); victim blaming (worüber beschwert sich Sevim, wenn sie doch immer Samets Nähe sucht?); ein Opfer, das nicht zu Wort kommt („Hier habe ich sie abgewürgt“, sagt der Schulleiter über das Gespräch mit Sevim); das männliche Einschwören auf Solidarität und „gesunden Menschenverstand“; das Bestreben, die Angelegenheit möglichst keine Wellen schlagen zu lassen.
Mysterium um eine Leerstelle

Auf trockenen Gräsern setzt das auch konsequent filmisch um, baut ein Mysterium um die Leerstelle herum, die damit mehr Sichtbarkeit erhält und Neugier schafft. Immerzu sehen und hören wir Männer; Sevim dagegen, die Katalysatorin der Handlung, ist kaum zu sehen, noch weniger zu hören. Ihr kindliches, vielleicht höhnisches, vielleicht forsches, vielleicht schüchternes Gesicht blitzt ab und an auf, brennt sich ins Gedächtnis – ganz besonders in der letzten Szene, in der sie über ihre Schulter schaut und ihr Blick den Zuschauer direkt herauszufordern scheint –, bleibt aber ein Rätsel, eine Projektionsfläche für Samet. In einer episch anmutenden Szene – die erste in diesem Film, die mit dem Winter bricht und den Sommer „auf trockenen Gräsern“ zeigt –, enthüllt Samets pathetisches Voice-over zwar nicht, was passiert ist, dafür aber das, was Sevim ihm bedeutet hat. Im Grunde beraubt er sie ihrer Individualität, sieht nur sich in ihr: „Ich möchte mich gern mit deinen Augen sehen“.

Von Energie, Transzendenz und einer Traumwelt ist die Rede, von etwas in ihm, dem desillusionierten, pessimistischen Mann, das wieder eine Verbindung zum Leben herstellen könnte. Gleichzeitig schlägt Samets soziale Verachtung einmal mehr durch: Wie er es schon seiner Klasse unverhohlen prognostiziert („Ihr werdet Kartoffeln und Zuckerrüben anbauen“), sieht er auch für Sevim keine Perspektive. Perspektive, davon ist Auf trockenen Gräsern aber überzeugt und kürt entsprechend seine Hoffnungsträger – allen voran Nuray (Merve Dizdar), die für ihre Ideale einsteht –, ist eine Frage der Haltung, ja Haltung schafft Perspektive.
Neue Kritiken

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Die Spalte
Trailer zu „Auf trockenen Gräsern“

Trailer ansehen (1)
Bilder

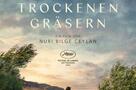


zur Galerie (9 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.











