A Woman, a Gun and a Noodleshop – Kritik
Zhang Yimous neuer Film ist eine derart krude Melange aus Teilen, die eigentlich nicht zueinander gehören, dass er mal eben sein eigenes, wunderliches Nicht-Genre kreiert: das Breitwand-Kammerspiel.

Zhang Yimou adaptiert das Debüt der Coen-Brüder – der Chefchoreograf der olympischen Eröffnungszeremonie von Peking nimmt sich der amerikanischen Meisterökonomen präzisen Storytellings an. Das nennt man wohl Clash of Cultures. Was an sich schon eigenartig klingen mag, wird spätestens dadurch zu einer wirklich fragwürdigen Angelegenheit, dass der Regisseur von Hero (Ying xiong, 2002) und House of Flying Daggers (Shi mian mai fu, 2004) Stil und Setting seiner letzten Werke treu bleibt und die Handlung von Blood Simple (1984) in ein mittelalterliches China voll knallbunter Farben verlegt.
Der Regisseur wollte ganz offensichtlich weg von gigantischen Breitwandepen à la Der Fluch der goldenen Blume (Man cheng jin dai huang jin jia, 2006), nur wollte er es nicht konsequent genug. So setzt er seinen Zuschauern eine äußerst unausgegorene Mischung aus Coen’schem Minimal-Neo-Noir und dem hauseigenen Panorama-Kung-Fu vor. Plus massenhaft überkandideltem, sehr chinesischem Slapstick. Doch das Resultat entbehrt komischerweise nicht eines gewissen, wenn auch verqueren Charmes.

Zhang Yimou konstruiert in A Woman, a Gun and a Noodleshop (San qiang pai an jing qi) nämlich eine hochgradig interessante Verbindungslinie zwischen amerikanischen Erzähl- und chinesischen Inszenierungstraditionen. Blood Simple war ja ein bis zur Essenz konzentrierter Malstrom aus Kausalzusammenhängen, in dem ein Missgeschick so zwangsläufig zum nächsten führte, dass man von narrativem Determinismus sprechen könnte. Eine bitterböse Mechanik des Action-Reaction.
Im klassischen Kung-Fu-Film wiederum wurden Kämpfe oft und gerne zu einer hochfunktionalen Mechanik aus Großaufnahmen von Händen, Füßen und Waffen konzentriert, was mindestens drei Gründe hatte. Erstens konnten so kostspielige und komplex zu choreografierende Totalen eingespart werden, zweitens betonten die emblematischen Close-ups die ungemeine Präzision der Kämpfenden, in der minimalste Bewegungen zu einem komplexen Schlagabtausch orchestriert wurden. Zuletzt war dies die originäre Domäne des Regisseurs, der die Meisterschaft und Genauigkeit seiner Inszenierung zur Schau stellen konnte.

Es ist also ein naheliegender Schritt, mithilfe dieser Mechanik der Großaufnahmen die fein herausgearbeiteten Strukturen der Coen’schen Erzählweise zu unterstreichen, diese Handkantenschläge des amerikanischen Genrekinos. Und das gelingt Yimou oftmals famos. Viele Einstellungsfolgen werden mehrmals exakt gleich wiederholt, was dem Film einen beizeiten strengen und klar akzentuierten Rhythmus verleiht.
Doch um Kung Fu an sich geht es in A Woman, a Gun and a Noodleshop gar nicht, sondern nur um dessen Inszenierungsformen im Film. Die chinesische Kampfkunst ist immerhin für zwei Lachnummern zu haben: In der ersten Szene fuchtelt ein grotesk überschminkter „Perser“ (Schnauzer, Ballonhosen, Zipfelhütchen) eher blamabel mit dem Krummsäbel durch ein weit abgeschiedenes Nudelhaus, später wirbeln die Köche virtuos mit Teig in der Küche umher (was recht offensichtlich bei Jackie Chans Mr. Nice Guy (Yat goh hiu yan, 1997) abgekupfert wurde).

Vieles will hier einfach nicht sinnhaft zusammenwachsen, die kulturellen Rahmen von Vorlage und Adaption zeigen sich zu widerständig, um zueinander zu finden. Die brutal komprimierte Erzählung der Coens funktioniert vor allem bei einem westlichen Verständnis von psychologischen Konfliktgefügen. Das dramatische Ausgeliefertsein der Charaktere, sowohl einander als auch den Gesetzen der Welt; all ihr Morden, ihre Vertuschungsversuche, die nur immer neue Konflikte schaffen, ihre Fehlinterpretationen der Motive der anderen: All das benötigt die Involvierung der mit den Konventionen vertrauten Zuschauer, um die nötigen Emotionen mit in die nackte Handlung zu bringen.
Doch Yimou bleibt gerade bei der Charakteranlage sehr chinesischen Mustern verhaftet: Seine Figuren sind streng typisiert, nicht wandelbar. Der Feigling bleibt der Feigling, der Trottel bleibt Trottel, der Killer Killer. Und diese grundsätzliche Verfasstheit drückt sich in ihren Bewegungen aus: Der Trottel stürzt mehr, als er läuft, der Killer bewegt sich ruckartig, minimal, genau. Die Schauspieler machen ihre Sache wirklich gut, aber sie sind nicht zu Hause in der Erzählform, sie führen ein Possenspiel auf der falschen Bühne. Aber mit dem richtigen Dekor.

Die Lokalitäten in A Woman, a Gun and a Noodleshop sind reduziert auf das erwähnte Nudellokal, dessen Keller und die umliegende Steinwüste. Bei Tag glühen die Maserungen der Felsen in verblasstem Rot, die schrillen Kostüme (pink, grün, orange) blitzen im Sonnenlicht. Ansonsten regiert eher Dunkelheit. Der Großteil der Handlung geschieht, wie bei den Coens, während einer nicht enden wollenden Nacht. Dann regiert ein düsteres, allumfassendes Blau die Szenerie. Yimou beherrscht die Farben noch immer.
Der Film schafft es also in all seiner abgefahrenen Heterogenität nicht, mehr als die Summe seiner Teile zu sein. Es stellt sich keine Harmonie ein zwischen den grimmigen Szenen der mörderischen Nacht und dem Herumgehüpfe und Gekreische bei Tag. Vielleicht war der Sprung dann doch zu weit.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Bilder zu „A Woman, a Gun and a Noodleshop“
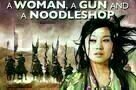



zur Galerie (7 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.












