Weißer, weißer Tag – Kritik
Trauer als Detektivarbeit: Ein Witwer beschäftigt sich obsessiv mit den Hinterlassenschaften seiner Frau und renoviert zu Therapiezwecken ein Haus. Weißer weißer Tag ist kein beruhigender Film, auch wenn er zunächst so tut.
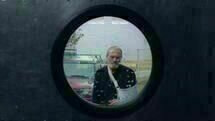
Ganz schön toughe Fragen, die der Psychotherapeut dem Mann mit den grauen Haaren da stellt: „Haben Sie noch Albträume?“, „Fühlen Sie sich einsam?“, und, am schlimmsten: „Wissen Sie, wer Sie sind?“. Er fordert Ingimundur (Ingvar Sigurdsson) auf, sich selbst zu beschreiben. „Ich bin ein Mann“, stellt Ingimundur entschlossen fest. „Weiter“, fordert sein Gegenüber. Ingimundur setzt also nach: „Ein Vater. Ein Großvater. Ein Polizist. Witwer.“ In der Aufzählung zeigt sich das Konfliktpotenzial, das Hlynur Palmasons Weißer weißer Tag (Hvítur, Hvítur Dagur) vorantreibt: weil jene Rollen des Protagonisten nicht so miteinander harmonieren wollen, wie sie es sollten, und weil jede schon für sich genommen eine ziemlich große Aufgabe ist. Mann, Vater, Großvater, Polizist, Witwer: Es gibt immer was zu tun.
Widersprüchliche Gefühle zulassen

Weißer weißer Tag ist demnach kein ruhiger, kein beruhigender Film, obwohl er zunächst so daherkommt. Es brodelt, es arbeitet da etwas – allen voran eben die Hauptfigur an ihrer Auseinandersetzung mit der eigenen Gefühlswelt. Nach dem Verlust seiner Ehefrau (Sara Dögg Ásgeirsdóttir) durch einen Autounfall beginnt Ingimundur sich obsessiv mit dem Vorfall und den Hinterlassenschaften der Partnerin zu beschäftigen, mit alten Fotos und Zeichnungen, mit dem Jeanshemd, an dem sich noch riechen lässt, dem Camcorder, den Ausleihscheinen der Bücher aus der städtischen Bibliothek, den Tagebüchern. „Ich hatte immer das Gefühl, dass sie mir etwas verheimlichte“, bemerkt er einmal. Das Detektivische, das der in uns nachlebenden Vorstellung von einer verstorbenen Person oft innewohnt, multipliziert Regisseur Palmason im Film: Denn es ist hier natürlich praktisch, dass Ingimundur nicht nur Mann und Witwer ist, sondern früher mal Polizist war. Kriminalakten werden also geklaut, Videoaufnahmen des Unfalls studiert, fix eine Affäre der toten Gattin aufgedeckt. „Lassen Sie die widersprüchlichen Gefühle zu“, rät der Therapeut.
„Wenn das Haus fertig ist, so kommt der Tod“

Von diesen Gefühlen erzählt der Film, ähnlich seinen Figuren, nicht so sehr über ein Verbalisieren von Eindrücken – die Therapiesitzung ist eine der wenigen Ausnahmen –, vielmehr arbeitet er sich am Material ab, ist selbst passenderweise auf 35mm gedreht. Anhand eines alten Hauses in der isländischen Einöde, an dem Ingimundur mitsamt der Familie einer seiner Töchter herumrenoviert, wird so der Trauerprozess sichtbar gemacht, auch dessen schiere Dauer; der Film entwickelt regelrecht ein Faible für das unfertige Bauobjekt in unterschiedlichen Wettersituationen und seine Fenster, die Aus- wie Einsicht versprechen. „Wenn das Haus fertig ist, so kommt der Tod“, heißt es in Thomas Manns Buddenbrooks, und so lässt sich auch in Weißer weißer Tag nur hoffen, dass es nie zur Fertigstellung kommt, so sehr ist das Werkeln am Haus therapeutisches Gruppenprojekt, so sehr konstituiert es erst das, was sich in diesem Film Familie nennt bzw. wieder zu nennen versucht.
Mit dabei auf der Baustelle, abgelegen vor Bergkulisse und mit ein paar Kühen, aber auch beim Autofahren durch Regen, Nebel und Schnee ist stets Enkelin Salka (Ída Mekkín Hlynsdóttir), in deren Gegenwart Ingimundur, wie er im Gespräch mit dem Therapeuten gesteht, sich nicht allein fühlt. Wortkargheit und Zärtlichkeit zeichnet das Verhältnis zwischen dem Großvater und dem kleinen Mädchen aus. Ingimundurs erwachsene Töchter derweil sind Ehefrauen und Mütter. Beruflich haben sie anscheinend keinerlei Verpflichtungen. Sie können den Vater nur immer wieder damit konfrontieren, dass sie die Mutter vermissen, was er als Gesprächsangebot nicht wahrnimmt. So unachtsam wie Ingimundur geht der Film kontinuierlich mit den Frauenfiguren um. Die Verstorbene beispielweise bleibt bis zum Ende namenlos, taucht in den Credits als „Ingimundurs Frau“ auf. Sie scheint nicht als konkrete Person mit Begehren wichtig, sondern ist bloße Idee und Gespenst, das gegen Ende des Filmes lächelnd, mit blonden Locken und nur im Handtuch bekleidet in der Imagination des trauernden Ehemannes wieder auferstehen darf.
Ikonografie männlicher Besitztümer

Bei der Frage danach, was denn von einem verstorbenen Menschen in Erinnerung bleibt, hat dieses Bild schon seinen Sinn. Dennoch bewegt sich Weißer weißer Tag in einer Ikonografie männlicher Besitztümer, bedient sich auffällig daran: das Haus, das Auto, die Ehefrau (eigentlich lieber lebendig als tot, und natürlich monogam unterwegs). Es ist daher bezeichnend, wenn Ingimundur in der Therapiesitzung auf die Frage, wer er denn sei, spontan „ein Mann“ entgegnet. So lässt sich Palmasons Film nämlich viel eher betrachten: Statt als allegorisch gemeinter, immerwährend gültiger filmischer Versuch zu Trauer, Pathos, Schmerz und Liebe (davon gibt es hier nur eine wahre) als Studie in Sachen Männlichkeit. Mit dieser Fokusverschiebung verändert sich der Film, wird in der Archaik, die seine Bilder von Landschaften, Isolation und Rohheit beschwören – etwa wenn Ingimundur mit bloßen Händen Steine aus dem Weg schafft –, unfreiwillig komisch.
„Haben Sie schon mal geweint deswegen?“, fragt der Therapeut mit Blick auf den Tod der Ehefrau, was Ingimundur verneint. Am Ende weint er dann aber doch. Langsam sammelt sich die Flüssigkeit in den Augen, die Kamera zoomt heran, immer näher, bis dann diese eine Träne ausbricht. In der Versöhnlichkeit, die das suggeriert, steckt aber noch etwas Anderes: die Faszination des Kinos für die Sichtbarkeit von Gefühlen, die Großaufnahme als Schauplatz von Erwartungen.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Weißer, weißer Tag“


Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (17 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.








