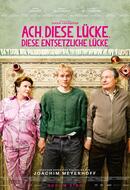Pio – Kritik
Im Gedränge der Hafenstadt Gioia Tauro können weder die Figuren noch die Kamera Abstand halten. Pio, der neue Film von Jonas Carpignano, erzählt vom Rand der Gesellschaft als Mittelpunkt der Welt.
Ein überfüllter Nachtclub in einer italienischen Hafenstadt. Zwischen blinkenden Lichtkegeln, vibrierenden Körpern und ohrenbetäubender Chartsmusik hält der 14-jährige Pio Ausschau nach seinem großen Bruder Cosimo, dem Vorbild, das für ihn für Männlichkeit und Anerkennung steht.

Pio, der neue Film von Jonas Carpignano (Mediterranea, 2015), erzählt in dichten, lauten Bildern von dem Leben einer Roma-Familie am Rande von Gioia Tauro. A Ciambra, so der Originaltitel, verortet die Handlung im berüchtigt prekären Teil der Stadt. Dort bilden Armut und Kriminalität das Umfeld, in dem Pio mit seinen kleinen Geschwistern aufwächst. Dass er noch ein Heranwachsender ist, möchte der Junge jedoch nicht einsehen. Immer wieder versucht er, sich in seiner Familie zu behaupten, will anerkannt werden, als vollwertiger Mann und ernstzunehmender Versorger der Familie. So wie sein Bruder, der unter anderem durch Autodiebstähle die vielköpfige Familie finanziert.
Unentrinnbarer Rauch

So gut wie jeder ist hier in illegale Tätigkeiten verwickelt. Selbst die Kleinsten müssen ihren Beitrag zum Einkommen erbringen, verbrennen alte Kabel, um daraus Kupfer zu gewinnen und es anschließend zu verkaufen. Feuer, das sich als verheißungsvolles Motiv durch den Film zieht, steht im Gegensatz zu dem unentrinnbaren Rauch, der die lärmigen Straßen füllt. Es scheint, als könnte die Kamera bei all dem Gedränge nicht anders, als sich in Großaufnahme über die vielen Gesichter zu bewegen: Für Abstand gibt es keinen Platz. Auch die Beziehungen untereinander sind geprägt von Distanzlosigkeit, sodass es Pio oft nach draußen zieht. Rauchend wandert er nachts durch die Straßen, auf der Suche nach dem nächsten Coup, bei dem er seinem Bruder beistehen kann.

Das Dröhnen der Musik, die immer wieder anschwillt, entspricht der Konsistenz der Bilder. Begleitet von schrillen Popsongs, folgen wir dem Protagonisten durch volle Räume, von denen es in Ciambra sehr viele gibt. So auch die Küche von Pios Familie, wo sich Kinder, Eltern, Onkel und Tanten zu einem chaotischen Haufen zusammenfinden. Hier wird viel geschimpft und geschrien, hier geraten alle immer wieder aneinander. Nur der stille Großvater hält sich weitgehend aus dem Geschehen zurück. Er steht für eine andere, vergangene Zeit. Wenn er von seinen Pferden erzählt, von der Freiheit, in der er einst lebte, erscheint dies wie eine unwirkliche Geschichte, der niemand mehr zuhört. Doch trotz des manchmal ziemlich rauen Umgangstones sind doch alle auch herzlich zueinander, lachen und weinen gemeinsam. Als der ältere Bruder und Pios Vater eines Tages von den stets präsenten Carabinieri festgenommen werden, gerät der familiäre Zusammenhalt jedoch ins Wanken.
Angst vor Aufzügen und Zügen

Oszillierend zwischen pubertärer Entschlossenheit und kindlicher Verzweiflung begibt sich Pio auf den gefährlichen Weg in Richtung Erwachsenwerden. Und muss bald feststellen, dass der bedingungslose Zusammenhalt der Familie nicht alles ist. Hin- und hergerissen zwischen moralischer Integrität und familiärer Verpflichtung, zwischen weit entfernten Sehnsüchten und harter Realität wird ihm kein Raum gelassen, auch noch Kind sein zu können. Seine Angst vor Aufzügen und Zügen, die klaustrophobische Zustände in ihm hervorrufen, steht emblematisch für die Ausweglosigkeit, die dieser Ort verkörpert, an dem eine vertikale Flucht so unmöglich ist wie eine horizontale. Entfernt die Kamera sich einmal, dann meist nur, wenn unsere Figur selbst Ausschau hält. Doch als wollte das Bild bei nächster Gelegenheit zur größtmöglichen Nähe zurück, finden sich unsere Blicke jedes Mal auf Pios ausdrucksstarkem Gesicht wieder, das die Bildfläche füllt.
Dichte erscheint hier nicht nur als räumliche Kategorie, sondern als Potenzial, das sich innerhalb der Zeit entfaltet; als engmaschige Erzählung, die durch ihre Nähe zum Dokumentarischen porös und offen bleibt. Die Beziehungen und Konflikte der Familienmitglieder, die fast ausschließlich von Laiendarstellern gespielt werden, scheinen untereinander nie statisch und festgeschrieben.
Porosität wird auch durch traumhafte Passagen erzeugt, die die Handlung brechen: Ab und zu begegnet Pio zwei märchenhaften Gestalten, einem Mann und einem Pferd. Sinnbild für Freiheit und Selbstbestimmung, erinnert dieses Phantasma an etwas, das Pio sich kaum vorzustellen vermag. „Wir gegen die Welt“ ist die letzte Lektion des Großvaters, bevor er stirbt. Und als sich die Angehörigen zu einem Trauerzug formieren, lässt der Film seinen Figuren eindrücklich Raum. Denn tatsächlich ist es die Gemeinschaft, die sie stark macht und das Potenzial zur Freiheit trägt. So lassen sich auch gemeinsam Ängste überwinden.
Mit neorealistischen Anklängen verschafft sich dieser eindrucksvolle Coming-of-Age-Film Zugang zum sogenannten Rand der Gesellschaft, der für seine Bewohner den Mittelpunkt der Welt darstellt. Eine entropische Dichtung, die sich mit voller Hingabe ihren Figuren verschreibt.
Neue Kritiken

Die Spalte

Hamnet

Die Stimme von Hind Rajab

The Housemaid - Wenn sie wüsste
Trailer zu „Pio“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (8 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.