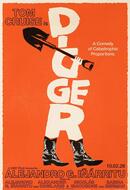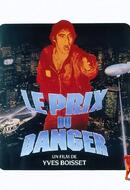28 Years Later – Kritik
Wenn schon der Weg zum Arzt zum lebensbedrohlichen Abenteuer wird: Danny Boyles Zombiefilm 28 Years Later erzählt von einer Welt, in der die Globalisierungsschübe der letzten Jahrhunderte rückgängig gemacht wurden und der Ausnahmezustand zur Normalität geworden ist.

In Danny Boyles 28 Days Later (2002) gibt es eine Einstellung, in der die Protagonist*innen – vier Überlebende einer tollwutartigen Seuche, die Menschen in reißende Bestien verwandelt, und England fast komplett entvölkert hat – in ihrem klapprigen Londoner Taxi auf einer Landstraße ein Blumenbeet passieren. Während das Gefährt unmittelbar unterm Horizont am obersten Bildrand kaum wahrnehmbar ist, füllen die Blumenreihen, in verschiedenen Schattierungen von Rot, Weiẞ und Rosa, im Stil impressionistischer Malerei verfremdet, beinahe das gesamte Bild. Gibt es in vielen Zombiefillmen seit Romeros wegweisendem Dawn of the Dead (1978) - dort im vierten Akt - Momente der Ruhe und Beschaulichkeit, weil die Figuren einem Übel erfolgreich entkommen sind, und noch nicht wissen, dass am Ende ihres Weges ein anderes, noch größeres auf sie wartet, bringt Boyle dieses Motiv mit seinem sonderbar schönen, spröden kleinen Idyll auf den Punkt.
Digitaler Hochglanz der Gegenwart

In 28 Years Later, der zweiten Fortsetzung des Films, die nun, siebzehn Jahre später in die Kinos kommt, gibt es eine Einstellung, die als visueller Widerhall dieses Bilds gelesen werden kann. Wieder sehen wir die Protagonisten des Films, den zwölfjährigen Spike (Alfie Williams) und seinen Vater Jamie (Aaron Taylor-Johnson), auf der Flucht. Doch dieses Mal fahren sie nicht, sondern rennen, einen der Infizierten auf den Fersen, den schmalen Weg entlang, der ihre kleine schottische Insel mit dem Festland verbindet und nur bei Ebbe passierbar ist, weil er bei Flut ganz vom Wasser verdeckt wird. Dieses Mal befinden sich die Figuren klein am unteren Bildrand, während über ihnen am imposanten Nachthimmel die Sterne zwischen Nebel und Wolken flackern.
Diese beiden Fluchtszenen zeigen pars pro toto die unterschiedliche inhaltliche wie ästhetische Matrix der beiden Filme: der defizitäre Charme der verschwommenen digitalen Videobilder des ganz frühen 21. Jahrhunderts hier, der digitale Hochglanz unserer Gegenwart dort. Das schrullige, aber noch deutlich der Moderne verpflichtete Gefährt, mit dem eine sympathische Außenseitertruppe durch eine Kulturlandschaft mit Straßen, Häusern und Feldern fährt, hier, ein ungleich archaischeres Szenario zwischen den Weiten von Meer und Weltall dort. Auch dass der Tag der Nacht gewichen ist und dass das eigentliche Geschehen wie der Horizont vom oberen an den unteren Bildrand verlegt wurden, verweist darauf, dass Days der einfachere, einer leidlich bekannten Genre-Formel folgende Film war, während die zentrale Heldenreise in Years um einiges verschlungener und auch spiritueller daherkommt.
Das Leben geht weiter

Die zentralen Impulse beider Fortsetzungen gehen auf das Finale des ersten Teils zurück, in dem die Gruppe aus dem Auto sich in den Fängen von Soldaten wiederfindet, von denen sie sich Hilfe erhoffen, die aber schnell zu ihren Peinigern werden. Hauptsächlich deshalb, weil die ausschließlich aus Männern bestehende Einheit in den beiden jungen Frauen der Reisegesellschaft nichts weiter sieht als eine für den Erhalt der Art notwendige Ressource, die ihnen als Lustsklavinnen und Gebärmaschinen dienen sollen. 28 Weeks Later, 2007 von Juan Carlos Fresnadillo inszeniert, erzählte 100 Minuten lang davon, dass die Verwaltung dessen, was nach der Apokalypse bleibt, in totalitäre militärische Barbarei kippt. 28 Years Later greift nun das Thema Fruchtbarkeit auf: Das gesunde Baby, das in der zweiten Filmhälfte von einer infizierten Frau geboren wird, ist ein utopischer Keim für das, was vielleicht nach dem Abspann oder aber im nächsten Sequel geschehen mag: Das Leben geht weiter.
28 Jahre später, im Jahr 2030, ist Alltag eingekehrt. Spike, sein Vater Jamie und seine Mutter Isla (Jodie Comer), die - so scheint es zunächst - schwer psychisch krank ist, unter psychotischen Episoden und unkontrollierbaren Wutausbrüchen leidet, leben in einer archaischen Gesellschaft. Bei den gefährlichen Ausflügen aufs Festland wehren sie sich gegen die Infizierten mit Pfeil und Bogen, es gibt keinen Strom und keinen motorisierten Verkehr, einige der älteren Bewohner*innen bewahren Fotos als Andenken an eine alte, vergangene Zeit auf. Das Festland hingegen ist in der Hand der Infizierten, die immer weiter mutieren: Einige von ihnen bewegen sich kriechend auf dem Boden, andere auf zwei Beinen, auf wieder andere, die sogenannten „Alphas”, hat die Infektion die Wirkung von Steroiden, die sie in riesige Hünen verwandelten, die - wie der Predator in der gleichnamigen Filmreihe - mit bloßen Händen den Kopf und die Wirbelsäule eines Menschen herausreißen können. Doch während das unter Quarantäne stehende Großbritannien durch die Seuche in der Zeit zurückgeschleudert wurde, befinden sich andere Teile der Welt im 21. Jahrhundert, mit Internet, Fernsehen, Amazon und einer modernen Armee.
Die längerfristige Wirkung des Virus auf die Welt ist eine radikale Segmentierung, die nicht nur den Globalisierungsschub, der mit den verkehrstechnologischen und medialen Revolutionen des 20. Jahrhunderts begann, teilweise aufhebt, sondern den vorherigen, dessen Startschuss 1492 Kolumbus’ erste Reise gen Westen war, gleich mit: Der Film spielt in einer Welt, in der Menschen nichts mehr vom Leben in anderen Ländern oder Kontinenten mitbekommen.

Turm aus menschlichen Schädeln
Auf dieser Grundlage erzählt der Film eine denkbar einfache Geschichte: Spike begleitet seine Mutter zum Arzt. Aber eben in einer Welt, in der allenthalben Monster warten, die eine zu Fuß wenige Tage dauernde Reise zum lebensgefährlichen Unterfangen machen. Besagter Arzt entpuppt sich schließlich als ins Positive gewendete, gutmütige Kopie des bösartigen kolonialen Phantasmas schlechthin: Unverkennbar erinnert Ralph Fiennes als Dr. Ian Kelson an Marlon Brando als Captain Kurtz. Er ist aber dessen genaues Gegenteil: Keine Figur, in der die berechnenden Verheerungen des europäischen Kolonialismus in Afrika (in Josephs Conrads Roman „Heart of Darkness“, 1899) bzw. des US-amerikanischen Kriegs in Vietnam (in der freien Verfilmung Apocalypse Now, 1979) in schieren Wahnsinn kippen, sondern eine aufklärerische Lichtgestalt: ein engagierter Arzt, dessen schaurige Insignien auf rationale und empathische Erwägungen zurückgehen. Seine Haut schimmert bedrohlich rot, weil er sich zum Schutz vor den Infizierten mit Jod einreibt, sein imposanter, etliche Meter hoher Turm aus menschlichen Schädeln ist unter den gegebenen Bedingungen die einzige Art, der Toten zu gedenken und an sie zu erinnern.

28 Weeks Later war ein früher Vertreter einer Reihe von Horrorfilmen, die als Spiegel der fundamentalen Verunsicherung der westlichen Welt in der Folge der Terroranschläge am 11. September 2001 fungierten: Die denkbar eindrücklichen Bilder der ersten zwanzig Minuten, in denen die Hauptfigur Jim (Cillian Murphy), nachdem er im Krankenhaus erwacht, wo er im Koma die Apokalypse verschläft und ziellos nach irgendeinem Halt suchend durch die verwüsteten, menschenleeren Straßen Londons irrt, sind Ausdruck eines Lebensgefühl der Verlorenheit und Verzweiflung: Die Welt, wie wir sie kannten, existiert nicht mehr. Die zutreffende Zeitdiagnose von 28 Years Later ist nun, dass der Ausnahmezustand zum Alltag geworden ist.
Neue Kritiken

Silent Friend

Small Town Girl

Der Fremde

Holy Meat
Trailer zu „28 Years Later“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (12 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.