Sherlock Holmes – Kritik
Sherlock Holmes ist nur das Label. Arthur Conan Doyles Ur-Detektiv muss sich durch einen konventionellen Actionfilm prügeln.

Sherlock Holmes gilt als Meister der logischen Schlussfolgerung. Der breite Erfolg seiner Geschichten trug maßgeblich dazu bei, analytisch-rationales Denken auch in der Prosaliteratur zu kultivieren. Rationalität kennzeichnet nicht nur die Ermittlungen des am Ende des 19. Jahrhunderts von Arthur Conan Doyle erdachten Detektivs sondern ist nicht weniger als das Schlüsselmerkmal der ganzen Figur. Ebenso bezeichnend sind allerdings auch genau die feinen Unebenheiten an der Oberfläche der mittlerweile selbst zum Stereotyp gewordenen Detektivfigur. Sherlock Holmes wandelt zwischen „Upper Class“ und Morphiumrausch, und doch ist er in keinem dieser beiden Kontexte richtig zu Hause. Die große Stärke von Doyles Figur ist, dass er sie nur rudimentär erklärt. So bleibt immer etwas Rätselhaftes an ihr. Sherlock Holmes wurde damit stilbildend und blieb gleichzeitig einmalig.
Das relativ konstante Interesse der Filmindustrie am Stoff der Doyle-Romane kann folglich kaum verwundern. Seit Arthur Marvins Sherlock Holmes Baffled (1900), beschäftigten sich etwa 30 Regisseure (darunter auch Billy Wilder und Steven Spielberg) gemeinsam mit gut 20 Holmes-Darstellern in mindestens 50 Produktionen mit dem kauzigen Detektiv. Besonders in den 40er Jahren, als Universal unter anderem beginnt, aus Doyles Stoffen Anti-Nazi-Filme zu stricken, gelangte ein Sherlock Holmes nach dem anderen in die Kinos.
Wer Doyles Romane oder ältere Verfilmungen kennt, wird das Kino nach Guy Ritchies Sherlock Holmes zumindest ein wenig irritiert verlassen. Auch der englische Regisseur verlässt sich zwar auf die einzigartige Ambivalenz der Figur, betont aber gleichzeitig einen Aspekt des Detektivs, der für gewöhnlich eine Fußnote bleibt: seine Körperlichkeit.

Bereits die erste Sequenz gibt den Takt des Films vor. Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) hetzt durch die Londoner Kanalisation. Ob er jagt oder gejagt wird ist zunächst unklar. Plötzlich friert das Bild ein und die Kamera zeigt, sich um eine starre Achse drehend, wie Holmes einem finster dreinblickenden Gesellen gegenübersteht. Er bereitet im Geiste eine Nahkampfeinlage vor und lässt uns aus dem Off daran teilhaben. Es ist die erste Kostprobe seines messerscharfen analytischen Verstandes. Dann zertrümmert der Meisterdetektiv seinem Gegner die Kniescheibe.
Guy Ritchies Sherlock Holmes ist kein reines Actionkino und doch ist diese Szene symptomatisch für einen Film, der seinem bekannten Protagonisten zwar unterm Strich nichts andichtet (Sherlock Holmes war schon immer leidenschaftlicher Boxer) und seine ursprünglichen Eigenschaften keinesfalls verleugnet, aber ihn dennoch zugleich zweckentfremdet.

London Ende des 20. Jahrhundert: Nachdem Sherlock Holmes mit seinem Partner Dr. John Watson (Jude Law) eine Serie grausamer Ritualmorde beendet hat, steht dem Täter, Lord Blackwood (Mark Strong), der Galgen bevor. Doch kurz nachdem Watson noch selbst den Tod des dunklen Aristokraten festgestellt hat, scheint Blackwood von den Toten auferstanden und versetzt ganz London mit weiteren Morden in nackte Panik. Erschwerend kommt hinzu, dass Holmes ein ernsthaftes Interesse an der amerikanischen Trickdiebin Irene Adler (Rachel McAdams) entwickelt. Doch die spielt ein doppeltes Spiel.
Es sind gleich zwei Liebesgeschichten, die viel Raum der Erzählung beanspruchen. Während Watsons Werben um die schlagfertige Mary Morstan (Kelly Reilly) eher konservativ verläuft, kommt es schon mal vor, dass Irene Adler den ihr zu Füßen liegenden Holmes narkotisiert und dann nur mit einem Kissen bekleidet an ein Hotelbett kettet. Robert Downey Jr. bekommt so die Gelegenheit, seinen Körper zu präsentieren und Sherlock Holmes kann die hübsche Amerikanerin in konventionell inszenierten Actionsequenzen gleich mehrmals vor Lord Blackwood beschützen.

Ebendieser Lord Blackwood ist von Guy Ritchie übrigens als Zitat der amerikanischen Anti-Nazi-Holmes-Adaptionen der 30er und 40er Jahre (Sherlock Holmes and the Voice of Terror, 1942; Sherlock Holmes and the Secret Weapon, 1943) angelegt. Mit schwarzem Ledermantel und Hitlerfrisur will er die Macht an sich reißen, indem er Angst und Schrecken verbreitet. Dass er am Ende das gesamte britische Parlament mit Giftgas ermorden will, erhält in diesem Zusammenhang einen äußerst merkwürdigen Beigeschmack.
Die jüngste Sherlock-Holmes-Adaption an Arthur Conan Doyles Romanen zu messen oder ihn mit früheren Verfilmungen zu vergleichen würde Guy Ritchies Film nicht gerecht, denn er hat schlichtweg etwas ganz anderes im Sinn. Auf Sherlock Holmes’ Oberfläche prangt zwar das Label „Sherlock Holmes“, aber Ritchie (Bube, Dame, König, grAs, 1998; Snatch – Schweine und Diamanten, 2000) verortet sich seit RocknRolla ohnehin wieder eher im Actionkino als im Kriminalfilm. Dass er aus Sherlock Holmes, dem Krimistoff par excellence, eine in jeder Szene konventionellen Actionkomödie macht, ist bezeichnend.
Neue Kritiken

28 Years Later: The Bone Temple

Silent Friend

Small Town Girl

Der Fremde
Trailer zu „Sherlock Holmes“

Trailer ansehen (1)
Bilder
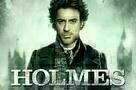
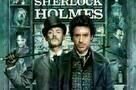


zur Galerie (23 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.















