Utopia – Kritik
Selbst ist der Zuhälter: In seinem Opus Magnum kartographiert Sohrab Shahid Saless den Nicht-Ort der Freiheit. Jetzt erscheint der Film zum ersten Mal auf DVD und Blu-ray.

Es dauert nicht lang, bis ein unangenehmes Gefühl der Enge aufkommt. Etwas mehr als drei Stunden werden wir fast ununterbrochen in der zum „Club Arena“ lieblos eingerichteten Altbauwohnung in Westberlin verbringen; ewiggleich zermürbend wiederholt sich dort der Alltag, oder besser die Allnacht, denn wie Tag und Nacht einander ablösen, das dringt kaum in den unglamourösen Kerker. Lediglich das Türklingeln der Kunden strukturiert die Zeit: Auf das Verharren in Einsatzbereitschaft an der Hausbar folgt lethargische Erholung, die keinem anderen Zweck zu dienen scheint als dem Warten darauf, dass sich die vorherige Nacht wiederholt. Gestützt wird das Gefühl des Verharrens – in der Zeit, in der eigenen Lage – von langen, ruhigen Einstellungen.

In diesem der öffentlichen Sphäre wie entzogenem Raum leben sie zu sechst: fünf Frauen, ein Zuhälter. Für ihn, Heinz (Manfred Zapatka), gibt es immer wieder Ausgang, Tageslicht, ein flüchtiges Leben jenseits des Clubs. Für Helga, Monika, Renate, Rosi und Susi aber schrumpfen die Grenzen der eigenen Lebenswirklichkeit zu den Wänden der öden Wohnung zusammen. Während Heinz fast ausschließlich im Anzug gezeigt wird und sich mit seinem Leben jenseits der Wohnung einen für uns unzugänglichen Raum beibehält, rückt man den fünf Frauen auf die Pelle, bekommt sie in jeder Kleidung, in jeder Situation zu Gesicht, wie gebilligt von einer gnadenlos dokumentarischen Kamera.
Wie Hoffnung das Sklavendasein zementiert

Und trotzdem bleiben sie etwas fremd, erfahren wir nur wenig über sie. Sohrab Shahid Saless hat sie nicht mit vor Misere strotzenden Schicksalen ausgestattet, ebenso wenig mit einer Vorstellung von Prostitution als Akt der sexuellen Selbstbestimmung oder gar der emanzipatorischen Freiheit. Gemein ist den fünf Frauen offenbar unterschiedlichen Alters und Hintergrunds, dass sie Geld brauchen; wofür, wissen wir nicht genau. Die Prostitution erscheint als ein Mittel zum Zweck. Immer wieder geht es um die baldige Zukunft, in der sie sich ihres Zuhälters entledigt haben und nicht mehr der Prostitution nachgehen werden.
Dass diese heraufbeschworene Zukunft eine Utopie bleiben muss, wird schnell klar in diesem vom Gefühl der Ausweglosigkeit durchtränkten Film. Utopia wälzt sich aber nicht im Elend. Es geht nicht darum, der Hoffnung mit genüsslicher Eiseskälte eine Absage zu erteilen, sondern eher zu fragen, was das, worauf sie sich richtet, eigentlich so utopisch macht, so völlig außer Reichweite erscheinen lässt; warum dieses andere Leben dazu verdammt ist, ein Sehnsuchtsort zu bleiben – was umso perverser ist, als diese Sehnsucht das Leben im Club Arena nicht nur erträglicher macht, sondern es für die Frauen legitimiert und damit erst ermöglicht. Denn beides ist schließlich Teil derselben Rechnung: heute Beine breit machen, morgen hochlegen.
Die Unmöglichkeit des Ausbrechens

In dem Dreiergespann Prostituierte, Zuhälter und Freier interessiert sich Utopia kaum für letztere. Weder werden die Freier eingehend porträtiert, noch wechseln sie sich in so hoher Frequenz ab, dass aus der Abfolge der Männer irgendein Typus erwächst, den man an den Pranger stellen könnte oder der als soziologische Erkenntnis daherkäme. Erwähnen kann man trotzdem Saless’ großartigen Seitenhieb, als das Kreuz an der Halskette eines Freiers der Prostituierten Rosi (Gundula Petrovska) während des Akts unablässig ins Gesicht schlägt. Doch Utopia spielt selten dort, wo fremde Wollust befriedigt wird; größtenteils sieht man die Frauen in den Gemeinschaftsräumen. Es geht nicht darum, aus den Zimmern am Rande etwas über die Mitte der Gesellschaft zu lesen, die augenscheinlich auch ihre Männer in fremde Betten entsendet. Es geht nicht einmal notwendigerweise um Prostitution. Es geht um Macht: wie sie entsteht, wie sie ausgeübt wird, gefestigt, zaghaft angeprangert und dann doch aufrechterhalten wird, wie gestärkt vom unfruchtbaren Aufbäumen. Was man mit den fünf Frauen in den Zimmern treibt, ist im doppelten Sinne außerhalb des Blickfeldes von Utopia. Der ganze Film dreht sich darum, wie ein System aufrechterhalten wird, dem manche anderen untertan sind.
Aufruf zur Selbstbefreiung

Das Verhältnis zur eigenen Unfreiheit scheint zunächst seine Entsprechung im Verhältnis zwischen der Prostituierten und dem Zuhälter zu finden, denn Heinz gibt den in seiner äußersten Kälte geradezu martialischen Sklavenhalter; die Gewalt, die von seiner Person ausgeht, scheint das komplette System zu stützen. Präzise zeichnet Saless die Widersprüchlichkeiten nach, mit denen es sich so leicht herrschen lässt. Er zeigt, wie Heinz einerseits die fünf Frauen erniedrigt und gleichzeitig die Sehnsucht nach seiner Aufmerksamkeit, nach einer Sonderbehandlung nährt; wie er ihnen einerseits ein und dasselbe unwürdige Schicksal ereilen lässt und sie gleichzeitig gegeneinander ausspielt, ganz in der Tradition des divide et impera.
Doch die Unmöglichkeit des Ausbrechens liegt nicht nur am mangelnden Zusammenhalt. Zum Schluss, als würde sich Saless ein kleines Sozialexperiment gestatten, inszeniert er den Tyrannenmord, der sich zur Tötungsorgie steigert. Keineswegs aber, grausige Lektion, läutet dies das Ende der Knechtschaft ein: „An die Arbeit“, heißt es dann von Renate (Imke Barnstedt), als ein ahnungsloser Kunde an der Tür klingelt, genau die Tür, die nun mehr denn je offensteht. An die Arbeit – vielleicht ist es das, was Utopia auch dem Zuschauer entgegenhält, ein Appell zur Selbstbefreiung. Oder bleibt die utopisch?
Der Text ist ursprünglich am 4.6.2016 im Rahmen unserer Sohrab-Shahid-Saless-Reihe erschienen.
Neue Kritiken

After the Hunt

Die toten Frauen

The Mastermind

Tron: Ares
Trailer zu „Utopia“

Trailer ansehen (1)
Bilder



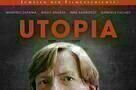
zur Galerie (11 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Peter Parlust
Zu schade, dass all den an und für sich guten Filmkritiken zu Utopia -wie hier- die großartige, im Grunde alles vorwegnehmende Eröffnungsszene verschlossen bleibt.
In dieser Eröffnungsszene wird aus den Wesendonck Liedern "Im Treibhaus" vorgetragen. Der Text des Liedes (Wagner) ist die perfekte Quintessenz des Folgenden und auf Saless Leben in der Diaspora selbst.
Und auch hier zeigt Sohrab Shahid Saless, was für ein kutlurelles Großkaliber er war und bleibt, und wie piefig und dumm,d.h. komplett ungebildet, die sog Öffentlich Rechtlichen offensichtlich sind, die es nicht fertigbringen, diesem iranischen Großmeister des deutschen Films mit einer restaurierten Fassung seiner Filme, die seit Jahrzehnten notwendige Ehre zu erweisen.
Peter Parlust
Yeah ! Utopia wurde am 18 Dez in einer perfekt restaurierten 16:9 Fassung auf BlueRay und DVD herausgebracht. Die BlueRay Qualität ist für einen solch alten Filme unglaublich gut. Die Farben und Kontraste sind akribisch perfekt remastered, der Ton fantastisch.
Zudem ist der Film im 16:9 Format zu sehen. Auf einem -wie hier- kalibrierten 77er OLED ein Kino Ereignis.
Das 2 Mann Unternehmen "Film-Shift" aus München hat einen unglaublich guten (Refernz-) Job gemacht. Besser geht es nicht - Danke und mehr (!)
Jürgen Bellm
Zur Kritik von Manon Cavagna:
“Während Heinz fast ausschließlich im Anzug gezeigt wird und sich mit seinem Leben jenseits der Wohnung einen für uns unzugänglichen Raum beibehält…“
Wie kommt man zu so einer Beobachtung eines „für uns unzugänglichen Raum(es)“, obwohl wir unzählige Male Heinz in seinem kärglich ausstaffierten Büro (noch Ofenheizung? Dit war Balin- der Radiator spricht Bände) bei allerlei Tätigkeiten beobachten, sei es beim Bilanzieren, Geld kassieren, allein auf seiner Liege dahindämmern, mit „Stichen im Kopf“ unter Schreien und Stöhnen auf Liege oder am Boden sich krümmend, seine(?) Annoncen ausschneidend und archivierend, sein Familienfotoalbum durchblätternd, seinen Traum erzählend, bei der Razzia, beim Frauen erniedrigen und „Bumsen“ etc. pp.?
Also, wie kann man so etwas beobachten oder besser gesagt nicht beobachten, wenn wir doch so viel zum Beobachten serviert bekommen?
@ Peter Parlust
Die großartige Eröffnungssequenz untermalt mit Wagners „Im Treibhaus“ der Wesendonck-Lieder erinnerte mich an die großartige "Eröffnungssequenz" von Annik Leroy´s 1980-81 entstandenen Film „In der Dämmerstunde-Berlin“ mit exakt demselben Stück, welches sich ebenfalls als Lei(d)tmotiv durch den Film zieht. Zeitgeist lässt grüßen;-)


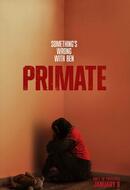

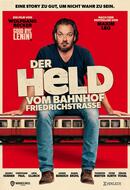












3 Kommentare